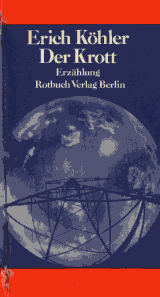»Seine Auffassung vom notwendigen Zusammenhang zwischen der Größe einer Sache und der Schönheit ihres sprachlichen Ausdrucks legt er in einer humoristischen Wendung Jordans Frau, einer engagierten Deutschlehrerin, in den Mund: "Große und richtige Gedanken müssen schlicht und schön gesagt werden. Mut und Freude müssen sie verbreiten: ›Seht, das haben wir uns vorgenommen.‹«
aus: Weimarer Beiträge - Heft 10 / 1978
Eva Kaufmann
Alt-Zauche
liegt nicht hinter den Bergen
Zu Erich Köhlers Werk und Weg
Im Frühjahr 1977 wurde Erich Köhler mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. Damit wurden nicht nur die beiden (1) ein Jahr vorher erschienenen Bücher Der Krott oder Das Ding unterm Hut und Hinter den Bergen gewürdigt, sondern auch ein schon zwanzigjähriges künstlerisches Schaffen. Wie kommt es, daß der Schriftsteller, dessen Bücher zum Wichtigsten und Interessantesten gehören, was die DDR-Literatur in den siebziger Jahren hervorgebracht hat, so wenig von sich reden macht? Auch Karin Hirdina beginnt ihre Betrachtung zu Köhler mit dem Ausdruck der Verwunderung (2) über die Stille um diesen Autor. Solche Stille hat viele Gründe. Einer liegt darin, daß man von Köhler sehr wenig weiß. Der folgende Artikel soll dem etwas abhelfen.
An Köhlers Lebensgang, über den alles bisher vorliegende Material nur lückenhaft Auskunft gibt, sind folgende Fakten von besonderem Interesse: 1950 bis 1955 arbeitete Köhler (Jahrgang 1928) als Bergmann bei der Wismut unter Tage, 1955-59 in Mecklenburg in der Landwirtschaft, hauptsächlich als Feldbaubrigadier. Danach studierte er am Becher-Institut in Leipzig. 1951 entstand der erste literarische Versuch, den er aus der Hand gab. 1956 erschien seine erste Geschichte Das Pferd und sein Herr. 1958 erhielt er einen Romanvertrag und nahm 1959 an der ersten Bitterfelder Konferenz teil, herausgestellt als Prototyp des schreibenden Bauern. Eine Weile hielt er es durch, drei Wochentage körperliche Arbeit in der LPG zu leisten und die übrige Zeit zu schreiben. Als er an dem Roman Schatzsucher (1964) arbeitete, gab er diese Doppelexistenz auf; der umfangreiche Roman war nur mit ungeteilter Arbeitskraft fertigzustellen.
Die langjährige arbeitsmäßige Doppelbindung formte ihn nachhaltig. Beide Lebenselemente stellten ihn in ein kompliziertes Spannungsverhältnis, das ihn in ständiger produktiver, oft auch quälender Bewegung hielt. Spannung und Widerspruch zeigten sich bereits bei seinem ersten Schreibimpuls. So hatte er, als er als Bergmann im Schacht arbeitete, eines schönen Tages Lust, über die nächtliche Begegnung mit einem weißen Reh zu schreiben. Da er aber fürchtete, niemand würde ihm eine solche wundersame Begebenheit glauben oder für aufschreibenswürdig halten, zog er es vor, etwas über das "wahre Leben", über den sorgenreichen Arbeitsalltag zu schreiben. Dem weißen Reh wurde zunächst einmal abgesagt, aber die Schreiblust selbst setzte sich durch. Mit einer Kurzgeschichte aus dem Bergmannsleben, die Köhler rasch niederschrieb und als Beitrag zu einem Wettbewerb an die Akademie der Künste sandte, vollzog er seinen ersten Schritt ins öffentliche literarische Leben. Er erhielt von Hans Marchwitza, dessen Buch Meine Jugend ihn tief beeindruckt hatte, einen freundlich ermutigenden Brief und den Rat "die Nährmutter Arbeit" (3) vorläufig nicht zu verlassen. Dieser Rat wurde beherzigt. Außerdem erhielt Köhler von der Täglichen Rundschau, der die Geschichte übergeben worden war und die sie nicht druckte, 400 Mark. Sie wurden, gemeinsam mit Kumpels, "auf den Kopf gehauen" (S. 164). Der selbstbewußte Häuer, mit einem Monatsverdienst von 1200 Mark, kommentierte lakonisch: "Geschenktes Geld mag ich nicht"" (S. 164) In etwa diese Zeit fällt auch Köhlers Idee zu einem Roman, der den Titel tragen sollte: "Geld spielt keine Rolle""
Vorerst aber wurden alle Schreibabsichten durch angestrengte Berufsarbeit beiseite geschoben. Köhler qualifizierte sich als Steiger und wurde "bis in die Träume hinein" (S. 165) von dieser Arbeit absorbiert. Er träumte von technischen Erfindungen, die das Vortriebs- und Förderwesen revolutionieren sollten. Und er schwankte, ob solche Ideen Gegenstand der Literatur sein sollten oder nicht. Zeitweise hält er es für eine Flucht vor der Wirklichkeit, über praktisch noch nicht gemeisterte Lebensfragen etwas Belletristisches zu schreiben. Da ihm jedoch bewußt wird, daß er sich die wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen für umwälzende Erfindungen schwerlich im Selbststudium erarbeiten kann, kommt er wieder auf den Gedanken zurück, ungelöste praktische Aufgaben mit Hilfe eines Romans insofern einer Lösung näherzubringen, als das Buch "vielleicht mehrere bessere Köpfe auf dieses Problem aufmerksam machen" könnte. (S. 67) Ein solcher Roman kam nicht zustande; aber Köhler beschäftigte sich auf der Abendschule mit dem Fach Deutsch.
1954 drängte ihn ein ganz anders gearteter Anlaß zum Schreiben. Die Entdeckung, daß das sozialistische Lager das Atombombenmonopol der USA gebrochen hatte, ließ ihn den Sinn der harten Arbeit in der Wismut tiefer begreifen. Das sollte auch anderen mitgeteilt werden. Er schrieb eine Ballade, heftete sie ans Wandbrett und konstatierte mit Genugtuung, daß sein Produkt von den Kumpels aufmerksam gelesen wurde. Diesen Schreibimpuls deutet er als "eine Art Eruption der Seele, die immer erfolgte, wenn ein gewisses, der Sache angemessenes Maß voll war" (S. 169). Es folgten Schreibanlässe von sehr profaner Natur. Aus privaten Gründen hatte Köhler seinen gutbezahlten qualifizierten Beruf im Bergbau aufgegeben, war auf ein Dorf in Mecklenburg gezogen und arbeitete dort im sogenannten "örtlichen Landwirtschaftsbetrieb", der bald zu einer LPG formiert wurde, aber lange ein überaus niedriges Produktionsniveau und entsprechend niedrige Löhne hatte. Mit 220 Mark monatlich geriet Köhler samt seiner wachsenden Familie in Geldnot. Sie brachte in Erinnerung, wie leicht er früher einmal mit dem Schreiben 400 Mark verdient hatte. Nun will er schreiben, um zu Geld zu kommen, mit dem ernsten Vorsatz allerdings, nicht über praktisch unbewältigte Probleme, sondern über ein Gebiet zu schreiben, auf dem er in der Praxis nicht "gekniffen" hatte. So verfaßte er die Geschichte Das Pferd und sein Herr, deren Handlung unter Soldaten im zweiten Weltkrieg spielt. Da er selbst nie Soldat war, hatte er die Unbefangenheit, “das Blaue vom Himmel herunter" (S. 180) zu fabulieren. Während der drei Monate, die er für die Geschichte brauchte, lebte die Familie vom kargen Geld, das die Frau verdiente, und sein Ansehen im Dorf gestaltete sich entsprechend. Aber er hielt durch und hatte damit Erfolg: Ein Verlag nahm die Arbeit sofort an und zahlte für das Produkt von drei Monaten Schreibarbeit mehr, als Köhler in einem Jahr Arbeit in der LPG verdiente. Als er einige Zeit später den Auftrag ausführt, etwas über seine LPG zu schreiben, und dabei auch Schwierigkeiten und ungelöste Probleme zur Sprache bringt, muß er mancherlei Vorwürfe, über sich ergehen lassen, darunter auch den der Besserwisserei, der mit der spöttischen Aufforderung verbunden wird, doch selbst den LPG-Vorsitz zu übernehmen. Diese Erfahrung bestätigt seine langjährigen Befürchtungen, daß besonders schwer über das zu schreiben ist, was praktisch noch nicht bewältigt wurde. Entziehen kann er sich diesen Schwierigkeiten jedoch nicht, am allerwenigsten, als er 1959 einen Roman zu konzipieren beginnt, der die Entwicklung auf dem Land zum Gegenstand hat. Mit diesem großen Schreibprojekt stellen sich neue Sorgen ein. Er weiß nicht, wie er die Umgestaltung der Landwirtschaft, die er für eine große Sache hält, adäquat zum “großen Gegenstand" (S. 186) der Literatur machen kann; er fürchtet, die Gestaltung des prosaischen Arbeitsalltags könnte zu kleinkariert geraten und in “bloßer Besserwisserei" (S. 186) steckenbleiben. Theoretisch scheint ihm die Lösung dieser Fragen darin zu liegen, "den totalen Zusammenhang des Weltgeschehens" (S. 186), in den sein begrenzter Gegenstand eingebettet ist, so breit und tief wie möglich aufzudecken.
Neben diesen spezifischen Schriftstellernöten beunruhigt ihn weiterhin das Ver hältnis von Wort und Tat, Handeln und Schreiben. Als Angehöriger der LPG erlebt er Tag für Tag, wie mühsam einfachste arbeitsorganisatorische Veränderungen und Verbesserungen der genossenschaftlichen Demokratie durchzusetzen sind. Angesichts dieser Praxiserfahrungen spottet er: "Es ist so einfach, unter Ausschaltung von Raum und Zeit zu erzählen, wie ein positiver Held (mit Hilfe von des Schreibers guten Ratschlägen) die schwierigsten Situationen meistert..." (S. 188) Auf der Suche nach der genauen Bestimmung seiner Fähigkeiten befragt er sich sehr hart und schreibt: "Ich glaube, schon in meinen Vorstellungen vom guten Ablauf der genossenschaftlichen Produktion liegt ein gut Teil Dichtung. Ich habe eben zu viel Phantasie. Ein Dichter ist eben ein Mensch, der in der Praxis an seiner Phantasie scheitert, an seiner Einbildungskraft, die eben größer ist als seine praktische Kraft." (S. 189) Während das Schreiben mehr und mehr ins Zentrum seines Lebens rückt, sucht er angestrengt nach solchen künstlerischen Möglichkeiten, die es erlauben, so zu schreiben, daß ihm niemand mehr das gefürchtete "Mach's doch selbst" (S. 189) entgegenhalten kann. Besonders beschäftigt ihn die Nötigung, vom spontanen Fabulieren zur "zielenden Schreibweise" (S. 183) überzugehen, das heißt, schon bei Arbeitsbeginn genaue Angaben über Aussage und Handlungsführung des geplanten Werks zu machen. Ihn beunruhigte, daß mit dem Abschluß eines Verlagsvertrages die Verpflichtung verbunden war, ein Exposé zu liefern. Einerseits empfindet Köhler diese Forderung als tief unangemessen, andererseits aber als einen produktiven Stachel, da er aus eigener Erfahrung weiß, daß auch das spontan fabulierte Werk "objektive Wirkung" (S. 183) ausät. Er ahnt, daß er sich auf die Dauer nicht "auf das Wunder der selbsttätigen Objektivierung verlassen" kann (S. 183). Wie hart ihn das Einstellen auf die "zielende" Schreibweise dennoch ankommt, zeigen seine überaus trockenen Worte zu dem in Arbeit befindlichen Roman Schatzsucher: "Ich habe meinen Roman noch einmal von vorn begonnen und will mittels seiner Handlung aussagen, daß der vom Monopol befreite Boden eine Quelle ständigen Reichtums für unser Volk ist, wenn er richtig genutzt wird." (S. 192) Zum damaligen Zeitpunkt sah er sein Problem darin, daß sich beim Schreiben Verstand und Phantasie im Wege stehen, daß er vom "Dichten zum Denken übergegangen" sei und eines Tages "zurückzufinden" (S. 192) hoffe. Das poetische Werk der siebziger Jahre zeigt, daß sich dieser Widerspruch zwischen Dichten und Denken produktiv gelöst hat und daß er den Autor auch weiterhin in Bewegung hält. Die ersten Erzählungen Das Pferd und sein Herr und Die Teufelsmühle (Erstveröffentlichung 1957/58) wertet Köhler als "Phantasieprodukte" mit winzigen realen Kristallisationskernen. Dieses Urteil verwundert etwas, denn weder haben sie mit Phantastischem zu tun, noch wirken sie frei und leicht fabuliert, wie Köhler es vom Schreibprozeß her empfand. Wie manch anderes Werk dieser Jahre geben Köhlers Erzählungen ein überaus stoff- und detailreiches Bild von Kriegsereignissen und -zuständen. Wo der erzählte Fall im Hinblick auf Grundfragen von Krieg und Frieden, von alter und neuer Gesellschaft, von sich aus keine Verallgemeinerungen ergibt, werden sie reichlich und lehrhaft (4) eingestreut. Viele der umständlichen, ja pedantischen Figurenreden klingen völlig unpersönlich. Oft agieren "Sprachröhren des Zeitgeistes". Die Handlung bewegt sich manchmal recht zäh voran. Welch immense Spanne künstlerischer Entwicklung liegt zwischen diesen oft unbeholfenen Anfängen (5) und Köhlers heutiger, äußerst verknappter, gedankenreicher und emotionsgeladener Prosa! Köhlers Geschichten entstehen in jenen Jahren, in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, da eine Reihe von DDR-Schriftstellern über den Krieg schreiben und dabei von ihren eigenen Erfahrungen als Soldaten ausgehen (Fühmann, Otto, Thürk, Noll und andere). Im Vergleich zu ihnen schneidet Köhler, der nicht von solchen direkten Erfahrungen ausgeht, nicht schlecht ab. Der Erfolg der Erzählung Das Pferd und sein Herr zum Beispiel - in relativ kurzer Zeit drei Auflagen - ist unter anderem daraus zu erklären, daß die Story kraftvoll genug ist, durch den Stoffballast "durchzuschlagen" und daß einige Charaktere echtes Interesse erwecken. Die Erzählung überzeugt, weil der, wenn auch langatmig erzählte Vorgang innere Logik hat und auch ohne die äußerlich bleibenden Kommentare Wichtiges über den Krieg aussagt. Köh-ler erzählt von einem Soldaten, den seine Pferdeleidenschaft in allzu enge Bindung an den Herrn eines besonders edlen Pferdes verstrickt, an einen Major, der sich mehr und mehr als gefährlicher Durchhaltekrieger entpuppt und seinen wenig kriegsbegeisterten Pferdeburschen bis "5 nach 12" zum Mitmachen bringt. Bei aller Didaktik sind die Figuren nicht nach einem Schwarz- Weiß-Schema angelegt, sondern aus einem lebendigen Widerspruch heraus entwickelt. Die Teufelsmühle ist der ersten Erzählung insofern thematisch verwandt, als es auch hier um einen Vorgang geht, in dessen Verlauf ein junger Bursche in den teuflischen Mechanismus des Krieges hineingezogen und schuldlos-schuldig wird am Tode eines Freundes. Köhler fabuliert hier mit einiger Sicherheit. Die Geschichte läuft, nachdem der erste Handlungsanstoß gegeben ist, folgerichtig kausal verknüpft ab. Das ist unbedingt ein Vorteil, denn so kann der Erzähler auf umständlich kommentierendes Dreinreden weitgehend verzichten. Das Geschehen selbst liefert die nötigen analytischen Aufschlüsse, indem es zum Beispiel erhellt, auf welche Weise der faschistisch mißbrauchte Treue-Begriff naive fünfzehnjährige Jungen zu Hetzhunden macht, die einen aus der NS-Heimerziehung entwichenen gleichaltrigen "Kameraden" zu Tode jagen.
Die folgenden Veröffentlichungen Köhlers tragen keinen fiktiven Charakter. Die authentisch zu nehmenden Aufzeichnungen Aus dem Marnitzer Tagebuch (1960) und die autobiographische Skizze Reiten auf dem Leben (1964) verraten in ihrer Eigenwilligkeit viel über die Entwicklung der poetischen Konzeption Köhlers. Er zeigt sich als ein gründlicher, kompromißloser Denker, der sich leidenschaftlich um Verständnis und Veränderung der eigenen und der gesellschaftlichen Situation bemüht. Dabei ergeben sich zuweilen Schwierigkeiten. Die Auszüge Aus dem Marnitzer Tagebuch (abgedruckt NDL, 4/1960) erscheinen gerade zu dem Zeitpunkt, da die Bewegung, die Dörfer vollgenossenschaftlich zu machen, auf dem abschließenden Höhepunkt steht. Dieser Kontext spielt für die damalige kritische Reaktion auf Köhlers Arbeit eine beträchtliche Rolle. - Entstanden war sie als Auftragsarbeit; das Becher-Institut hatte Köhler die Aufgabe gestellt, über die Entwicklung einer bestimmten, ihm lang vertrauten LPG zu schreiben. In den sechs Praktikumswochen ließ er sich im Rinderstall schwerste und ungewohnte Arbeit aufladen und versuchte, in denkbar engster Tuchfühlung den wirklichen Veränderungsprozessen auf die Spur zu kommen. In seinen Aufzeichnungen hält er sich nicht lange mit der Vorstellung des "Milieus" auf; er schreibt sehr bald über Schwierigkeiten und ungelöste Probleme. Eingehend erörtert er jene Mißstände in der Arbeits- und Lebensweise, die die Entwicklung hemmen und dem Sinn des Sozialismus widersprechen. Dabei operiert er ausgiebig mit exakten Zahlen und Berechnungen. Es frappiert, wie unumwunden er komplizierte Fragen angeht und mit welch schlagender Sachkenntnis und Sachlichkeit er argumentiert. Er bleibt auch nicht bei der Beschreibung von Mißständen stehen, sondern deckt die im Ökonomischen liegenden Fehlerquellen auf und macht begründete Verbesserungsvorschläge. Vor allem geht er der Frage nach, warum LPG-Mitglieder viel und schlecht arbeiten und dabei ein kärgliches, kulturloses Leben führen. Er hebt hervor, daß die ständige Verletzung des Prinzips "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Leistungen" die Entwicklung dieser LPG empfindlich stört. Am Ende dieser Studie liegt die Änderbarkeit, zum Teil auch die Veränderung selbst klar auf der Hand, so daß Köhler abschließend zuversichtlich verallgemeinern kann: "Das Leben setzt neue Probleme, und der Mensch löst sie interessant und aufschreibenswert. Es ist eine fortwährende Setzung und Überwindung von Widersprüchen”. (6)
Mit dieser kritisch-konstruktiven Wirklichkeitsdarstellung stieß Köhler damals auf heftigen Widerspruch. Dem auszugweisen Abdruck des Köhlerschen Textes sind kommentierende Notizen Eva Strittmatters beigegeben, die zu jener Zeit dem Redaktionsbeirat der NDL angehörte. Es wird kritisiert, daß sich die positive Entwicklung im "Gestrüpp der Erscheinungen” (7) verliere, daß Köhler nicht die rechte Liebe zum Menschen habe und nicht auf die richtige Weise "nahe an das Leben” (8) herangekommen sei. Das zusammenfassende Urteil lautet: " . . . das Auge des Dichters war aufmerksam, sein Bewußtsein jedoch war nicht wach genug." (9) (Diese Episode macht übrigens verständlich, warum Eva Strittmatter heute mit solcher Erbitterung auf ihre Tätigkeit als Literaturkritiker zurückblickt.) Erfahrungen dieser Art, die keineswegs exzeptionell, sondern zeittypisch waren, hinderten Köhler jedenfalls nicht, als es bei nächster Gelegenheit um unverhüllte Darlegung authentischer Erlebnisse ging, mit unbedingter Wahrhaftigkeit vorzugehen. Gemeint ist die anfangs zitierte Skizze Reiten auf dem Leben (entstanden 1963), die sich in dem Band Erkenntnisse und Bekenntnisse, der anläßlich des bevorstehenden 5. Jahrestages der ersten Bitterfelder Konferenz zusammengestellt wurde, ungewöhnlich ausnimmt.
Auffallend ist, wie freimütig und sachlich Köhler seine eigenen Probleme und Nöte öffentlich ausstellt. Er erreicht dabei eine eigenartige Mischung aus Objektivität und subjektiver Betroffenheit. Hier artikuliert sich eine schöpferische Individualität, die ihre Erkenntnisse anderen nicht penetrant aufzwingen will, sondern zur Prüfung anbietet. Diese Skizze hat Stil, auch im Sprachlichen. Der Ausdruck ist dichter, präziser geworden. Mit zäher Geduld, vielleicht sogar "Sturheit” (10) arbeitet er sich in immer neuen Anläufen durch mancherlei Schwierigkeiten stetig voran.
In dem nach mehreren Ansätzen entstandenen ersten großen Roman kommt Köhler auf das Stoffgebiet des Marnitzer Tagebuchs zurück. Schatzsucher kombiniert das "LPG"-Thema (befreiter Boden als Quelle des Reichtums) mit dem Kunstproblem. Ein Mann, der malt, wird mehr und mehr zur Hauptfigur einer episodenreichen, schwer überschaubaren Handlung. Merkwürdig dabei ist, daß Köhler diese Komponente nicht erwähnt, als er 1966 im Zusammenhang mit der Scholochow-Rezeption über sein Buch spricht, sondern Folgendes an seinem Buch hervorhebt: "Ein ideal denkender Mensch zweifelt an der inneren Größe seiner Weggenossen und findet im Verlaufe der Handlung manchen seiner Zweifel bestätigt. Durch das geduldige und beharrliche Wirken einiger hervorragender Gestalten kommen jedoch die übrigen in das Vermögen, den Zweifler im großen und ganzen ad absurdum zu führen und ihn sogar eines Besseren zu belehren, indem sie progressiv auf sein Gesamtwerk reagieren." (11)
Es ist für den Roman durchaus nicht nebensächlich, daß der "ideal denkende Mensch", die eigentliche Hauptfigur des Werks, ein Künstler ist. Damit macht Köhler die Rolle von Kunst und Künstler in der sozialistischen Gesellschaft sehr direkt zum Gegenstand künstlerischer Auseinandersetzung, eine Erscheinung, die sich Anfang der sechziger Jahre auch bei einigen anderen Schriftstellern der DDR zu entwickeln beginnt. Bei Köhler zieht sich das Kunstproblem von nun an wie ein roter Faden durch das gesamte Schaffen, mit der Besonderheit, daß die Künstlerfigur stets in übergeordnete allgemeine soziale Problemstellungen und Prozesse hineingestellt wird. Mag sein, daß Köhler durch den eigenen Entwicklungsgang, der ihn unmittelbar praktisch gesellschaftliche Tätigkeit und künstlerische Arbeit als einen Problemzusammenhang erleben ließ, immer wieder auf diese Thematik hingelenkt wurde. Im Schatzsucher wird ein Funktionsmodell von Kunst entwickelt, in dem sich der Kunstproduzent von der Lebensweise her nicht vom Produzenten materieller Güter unterscheidet und daher auch mit seinem Publikum in direktem Kontakt steht, ein Modell also, das Köhlers damaliger Lebenspraxis sehr nahe war. Gezeigt wird das Entstehen und Wirken von Kunst ohne vermittelnde Instanzen, gleichsam im "Naturzustand" ursprünglicher Arbeitsteilung und spontaner Kommunikation. Dieses Modell wirkt nicht utopisch, da Köhler es aus einer realen Situation heraus entwickelt. Sein Held ist ein LPG-Mitglied, das neben seiner landwirtschaftlichen Arbeit zu malen beginnt. Die Handlung zeigt, daß sein Heraustreten aus der schweren körperlichen Arbeit durch den gesellschaftlichen Nutzen, den.seine Bilder stiften, vollauf gerechtfertigt ist. Kunst interessiert Köhler nicht an sich, sondern in ihrer Funktion innerhalb der Gesellschaftsentwicklung, die die Handlung wesentlich ausmacht. Die künstlerische Überzeugungskraft des einen hängt mit dem Gelingen des anderen untrennbar zusammen, bedingt seine Stärken und Schwächen. Reden wir von letzteren, weil sie heute sehr ins Auge fallen.
Trotz vieler origineller Ideen prägt sich der Roman wenig ein. Er wirkt "überanstrengt", zum Beispiel in dem, was er an Tempo und Umfang gesellschaftlicher Veränderungen auf dem Lande vorführt. Die Handlung reicht vom Frühjahr 1958 bis Oktober 1959. Während zu Anfang am Handlungsschauplatz nur eine schlecht arbeitende LPG existiert, sind am Ende zwei Dörfer vollgenossenschaftlich und zu kooperativer Arbeit vereint. Hier wird der Vergesellschaftungsprozeß (mit der Tendenz zur Kooperative und Spezialisierung), der in Wirklichkeit weit in die sechziger, teils sogar in die siebziger Jahre hineinreicht, auf eineinhalb Jahre zusammengedrängt und abgeschlossen, ehe noch in der DDR die Bewegung zur Schaffung vollgenossenschaftlicher Dörfer voll im Gange war. Solche Verkürzungen und Verdichtungen sind künstlerisch legitim, doch bedürfen sie entsprechender Motivierungen. Nur außerordentliche Bedingungen könnten einen so grundsätzlichen, sprunghaften Wandel von Menschen und Verhältnissen, wie sie in Schatzsucher unterstellt werden, glaubhaft machen. Aber es gibt sie nicht, und daraus entsteht der Eindruck, als ob sich die anfangs hochauftürmenden Schwierigkeiten leicht und schnell überwinden ließen. Damit aber kommt in dem Roman, der auf direkte Vorbildwirkung aus ist, ein Aussageelement zustande, das die Leser über die tatsächlichen Schwierigkeiten hinwegtäuscht. Die Handlung führt vor, was sein soll. Dagegen wäre nichts einzuwenden, wenn sie dabei nicht unterschlüge, was ist. Die direkt "abschildernde" Manier verhindert jedoch, daß die Doppelheit dessen, was ist und was sein soll, richtig wahrgenommen wird. Vielmehr vermischen sich beide Aspekte in der Weise, daß sich das, was sein soll, als schon gegebene Realität ausgibt. In der Handlung, die in chronologischer Abfolge das Fortschreiten kollektiver Eigentumsformen und sozialistischer Arbeitsweise nachzeichnet, tritt der moralische Konflikt zwischen Eigennutz (12) und Gemeinnutz kräftig hervor. Das titelgebende, an Bürgers Fabel Der Schatzgräber angelehnte Schatzsuchermotiv gibt dazu die direkte verbale Verallgemeinerung. Die zum Teil dramatische Zuspitzung dieses Konflikts ist besonders an die Figur des malenden "ideal denkenden Menschen" Ramm gebunden. Ramm ist derjenige, der am leidenschaftlichsten gegen bäuerlich-kleinbürgerliche Besitzgier und Bereicherungssucht anrennt. Der moralische Rigorismus, der die Handlung immer wieder in lebhafte Bewegung setzt, motiviert sich überzeugend aus Ramms proletarischer Herkunft. Er war als bewußtes, allerdings wenig theoretisch geschultes Parteimitglied von seiner Gleisarbeiterbrigade aufs Land delegiert worden, hatte dank seiner Überzeugungsgabe schnell eine LPG gegründet, dann aber zunehmend bei deren Leitung versagt, so daß er - bei Handlungsbeginn - von einem Spezialisten in der Genossenschaftsleitung abgelöst werden mußte. Ramm repräsentiert damit einen gar nicht so seltenen individuellen Entwicklungsgang, wenn man sich an die Losung "Industriearbeiter aufs Land" erinnert.
Köhlers scheiternder proletarischer LPG-Vorsitzender aber beginnt zu malen. Und das hat mit seinem praktischen Scheitern und mit seinem moralischen Rigorismus viel zu tun. Tugenden und Fehler sind dieser Figur reichlich zugemessen: auf der einen Seite die absolute Uneigennützigkeit (13) und Aufopferung für die Sache, auf der anderen die Verbohrtheit in seinem Privatkrieg gegen die materielle Interessiertheit, - jagt er doch sogar Traktoristen vom Feld, weil sie nicht "wegen der Sache", sondern wegen der Prämie arbeiten. je mehr Ramm als praktischer Leiter im Umgang mit Menschen versagt, desto mehr verlegt er sich aufs Malen, und Köhler fügt es so, daß Ramm mit seinen Bildern erstaunliche menschenverändernde Wirkungen erzielt. Dies ist letztlich auch der Grund dafür, daß Ramm vom Klassenfeind für den "wirksamsten Kommunisten" (14) am Orte gehalten und erschossen wird. Zweifellos ist Ramm die Figur, mit der Köhler am meisten sympathisiert, mehr als mit den politisch und ökonomisch erfahrenen Leitern Pflock und Eisenkolb, die die notwendigen praktischen Voraussetzungen für eine gemeinschaftliche Arbeits- und Lebensweise schaffen. Ihnen, die voll auf das Prinzip der materiellen Interessiertheit bauen, begegnet der Erzähler respektvoll und kühl. Ramm dagegen, der die "materiellen Hebel" als äußeres Ziehmittels (15) und notwendiges Übel betrachtet und sich damit praktisch oft ins Unrecht setzt, schenkt der Erzähler seine emotionale Anteilnahme. Er läßt ihn stärker als die anderen Figuren leiden, irren und triumphieren. Fast wird Ramm zum Menschenhasser. In seinem Zorn auf den privatbäuerlichen Egoismus fertigt er kritische Porträtskizzen an, die ein strenges Sündenregister abgeben. In den Gesichtern sieht er nur das "Arge, Listige, Verschlagene, Hämische, Höhnische, Fade, Freche, Dumme, Brutale, Gemeine, Verlogene, Gierige und Lauernde" (16). Er weist sogar das berühmte Wort "Ein Mensch, wie stolz das klingt", als unglaubwürdig zurück. Am Ende aber findet er die Kraft, als Gegenstück zu den wirklichen Menschen das Bild eines edlen, uneigennützigen Menschen zu malen, der sich im antifaschistischen Kampf aufgeopfert hat, und mit diesem Mittel die anderen in Richtung auf das sozialistische Ideal ein Stück voranzubringen. So ist es die Kunst, die den Bauern hilft, über ihren Schatten zu springen und ein Stückchen jener Größe zu gewinnen, nach der der Autor mit seinem Roman auf der Suche ist.
In der Auseinandersetzung mit Scholochow, der in seinem Werk selbst der Revolution feindlich gesonnene Bauern zu "ästhetisch wirksamer Größe” (17) emporwachsen läßt, gelangte Köhler zu der Auffassung, daß es auf Grund der negativen Seite der deutschen Geschichte schwer sei, "Stolz und Größe" (18) im Handeln der Zeitgenossen zu gestalten. Sicherlich hat Scholochows Eigenart, die "Doppelseele" des Bauern tief zu analysieren, maßgeblichen Einfluß auf die Größe von Gestalten und Handlungen. Köhler dagegen versucht, diese Größe aus der Gegenüberstellung mit der BRD-Entwicklung zu gewinnen. Er erfindet eine ganze Reihe von Episoden und Figuren, die in der BRD angesiedelt sind und die historische Rückständigkeit kapitalistischer Verhältnisse demonstrieren. Das aber bleibt illustrative Zutat und trägt wenig dazu bei, die Entwicklung hier in die in ihr widerstreitenden Figuren zu der "ästhetisch wirksamen Größe" werden zu lassen, die der Dimension der historischen Leistung entspricht, als die Köhler die sozialistische Umwälzung der Landwirtschaft in der DDR wertet.
An dieser Stelle sei erinnert, was Köhler in seiner Skizze Reiten auf dem Leben zu dem selbst beobachteten Dilemma von Dichten und Denken äußert. Die nach Schatzsucher geschriebenen kleinen Prosawerke Nils Harland und Die lange Wand (entstanden 1964-1966) führen aus dem Zwiespalt zwischen unbefangenem Fabulieren und "zielendem" Konstruieren ein beträchtliches Stück hinaus. -In beiden Fällen dreht es sich um sehr handlungsstarke Vorgänge, um "unerhörte Begebenheiten". Im Unterschied zum Roman sind die Gegenstände entschieden begrenzt, Zeit und Ort nur vage umrissen. In Nils Harland ist Köhlers Faszination durch E. A. Poe zum erstenmal deutlich zu spüren. In einem unheimlichen Moorgebiet an der holländischen Grenze kommt es zu einer schicksalhaften Verstrickung zweier, der Einsamkeit und dem Moor verschworener Charaktere, die für den einen tödlich endet. Nirgendwo findet sich ein Satz, der die "Moral von der Geschicht" erläuterte. Dafür enthält die Geschichte Fragen und Anstöße, über Schuld und Unschuld, Individualismus, Humanität und Verantwortung nachzudenken. Ein erheiterndes Gegenstück dazu ist die Erzählung Die lange Wand, in der Köhlers Talent zum Komisch- Satirischen auffällt. Schauplatz ist irgendein Ort in der BRD irgendwann nach dem zweiten Weltkrieg, eine Situation jedenfalls, in der Kriegsverehrung und militaristische Gehorsamszwänge noch als gesellschaftliche Norm funktionieren und die Grundlage einer merkwürdig verzwickten Geschichte bilden. Es geht um einen alten Mann, dessen Stolz darin besteht, seinen Namen seit Jahrzehnten auf einem Denkmal eingraviert zu wissen, das die Gefallenen des ersten Weltkrieges verzeichnet. Durch mancherlei Vorkommnisse und unter vielem Hin und Her wird er dazu gebracht, sich von dem ihm teuren Gut zu trennen und die Inschrift selbst auszulöschen. Auch diese Geschichte ist von stofflichem Ballast weitgehend entlastet, sehr konzentriert und sprachlich bewußt erzählt. Die Variabilität der Erzählweise Köhlers entwickelt sich spürbar. Für jedes Sujet findet er eine entsprechende Machart, einen speziellen Gestus. Die Geschichten basieren auf einem poetischen Grundeinfall, in dem Thematisches und Gestalthaftes (meist ein gegenständlich anschauliches und bedeutungstragendes Detail) zusammenfallen.
Wie Problem und Gestalt sich gegenseitig bedingen und ineinander umschlagen, zeigt sich besonders in der Geschichte Gespensterwald von Alt-Zauche von 1970. Hier wendet Köhler - ähnlich wie der Kubaner Alejo Carpentier in seiner Erzählung Reise zum Ursprung - die Technik des rückwärtslaufenden Films an. Durch die innere Logik ihres Gegenstands kommen beide Autoren, obgleich von überaus unterschiedlichen kulturellen und literarischen Traditionen geprägt, fast zeitgleich zu analogen künstlerischen Verfahren. Bei Köhler wird der Leser Zeuge eines phantastischen Vorgangs: merkwürdig verkrüppelte Bäume verwandeln sich in ihren unbeschädigten Urzustand zurück. Als Ursache ihrer Verkrüppelung werden Kriegseinwirkungen erkennbar. Die geistige Dimension der Geschichte erschöpft sich allerdings nicht in der Feststellung, daß man heute immer noch vielerorten unvermutet auf Kriegsfolgen stoßen kann. Das lohnte kaum den künstlerischen Aufwand. Diese untendenziöse, assoziationsstiftende Art des Erzählens erfordert freilich ein hohes Maß von Leseraktivität und Leseerfahrung. Die Bemühung um eine ausdrucksstarke, poesieerfüllte Kunst beschäftigt Köhler so intensiv, daß er sie mehrfach, sogar in Kinderbüchern (19) zum Gegenstand künstlerischer Darstellung machte. Ende der sechziger Jahre enstand Der Geist von Cranitz, ein Werk, dessen Schicksal sehr wechselvoll verlief. Ende 1968 veröffentlichte Sinn und Form dreizehn Seiten Prosatext mit folgender Anmerkung: "Aus Erich Köhlers Erzählung Der Geist von Cranitz, die im Hinstorff-Verlag, Rostock, vorbereitet wird, bringen wir den letzten Teil." (20) Da es bei der Teilpublikation des Prosawerks blieb, Theaterleute sich aber interessiert zeigten, entschloß sich Köhler zu einer Dramatisierung, die 1972 von Theater der Zeit abgedruckt und 1972 einige Male ohne nachhaltigen Erfolg aufgeführt wurde. Da ein vollständiger Prosatext von Geist von Cranitz nicht gedruckt vorliegt, wird hier auf den Stücktext zurückgegriffen, wobei die besonderen Probleme, die Drama und Theater, vor allem auch das Kindertheater in Köhlers Schaffen spielen, ausgespart bleiben. Dies ist eine eigene Untersuchung wert und wird dann sinnvoll, wenn der geplante Stücke-Band vorliegt.
Köhler kommt im Geist von Cranitz auf die Kombination von Gesellschaftsentwicklung (LPG) und Künstlerproblematik zurück, jedoch mit weiterentwickelten und vertieften Fragestellungen. Die Rolle des im Mittelpunkt stehen den Künstlers - diesmal ein Bildhauer - wird neu bewertet. In Schatzsucher versagte der Künstler in der praktischen Leitertätigkeit und triumphiert durch seine Bilder. Anders der Bildhauer Zollda: er übt als Bildhauer zwiespältige Wirkung aus, indem er dem Prozeß der Kooperationsbildung zugleich nützt und schadet. So erscheinen Kunstproduktion und -wirkung wesentlich dialektischer und realistischer als im Roman Schatzsucher, in dem alles auf moralische Läuterung hinauslief. Im Stück dagegen geht es um vielfältige Wirkungen von Kunst, um eine Kunst, die durch ihre hintergründige Art ihr Publikum provoziert, spaltet, zum Nachdenken zwingt. Beispiel dafür ist besonders ein Werk Zolldas, eine riesige, aus einem Findling geschlagene Kröte auf dem Wege zum Dorfe Cranitz. Köhler zeigt, daß es nicht nur an diesem Kunstding, sondern vor allem an den Betrachtern und an deren Verhältnis nicht nur zur Kunst, sondern vielmehr zur Wirklichkeit selbst liegt, wie sie auf den kunstvollen "Stein des Anstoßes" reagieren. Entsprechend ihrer unterschiedlichen Haltung zur geplanten Kooperative interpretieren die einen das geheimnisvolle Krötentier als verwunschenen Prinzen, die anderen aber als "Giftlurch", als Inbegriff alles Häßlichen. Im Streit um das Kunstding schält sich deutlicher heraus, warum die einen vorerst in der Froschperspektive der einzelnen LPG befangen sind, während die andere sich zum Höhenflug größerer Gemeinschaftlichkeit des Arbeitens und Lebens erheben. Auch Der Geist von Cranitz zeigt einen positiven Fall von Kunstwirkung, im Unterschied zu Schatzsucher jedoch nicht feierlich-ernst und messianisch, sondern weitgehend komisch gefärbt und den Spielcharakter bewußt ausstellend. Im Zusammenhang damit bleibt dem Künstler Zollda erspart, als Märtyrer geopfert zu werden. Im Stück versucht Köhler in dreierlei Richtung ästhetisch vorzustoßen: Verknappung, Poetisierung und geschichtsphilosophische Vertiefung. Das ist eine Tendenz, die seit Ende der sechziger Jahre in der DDR-Literatur häufiger auftritt. In Köhlers Stück erscheint das Wirklichkeitsmaterial geistig viel stärker durchdrungen und durch äußerste sprachliche Verknappung, die durch die dramatische Fassung besonders forciert wird, gleichsam kondensiert. Manches bleibt dabei freilich noch unausgegoren, gewaltsam und disparat.
Von der Cranitzer Kröte ist der Weg nicht mehr weit bis zum Krott, bis zum Prosawerk Der Krott oder Das Ding unterm Hut. (21) Das Genre dieses von Witz und poetischen Einfällen sprühenden Büchleins ist schwer bestimmbar. Köhler nennt es eine Skizze. Dafür sprächen die stark ausgeprägten essayistischen und reportagehaften Elemente, die aus der besonderen Entstehungsgeschichte des Buchs resultieren. Vom Kraftwerk Lübbenau, in dem er sich längere Zeit aufgehalten hatte, ließ sich Erich Köhler beauftragen, etwas Operatives über Energieerzeugung zu schreiben. Das setzte eine intensive Bemühung um die technisch-wissenschaftliche und die arbeitsorganisatorische Seite der Energieerzeugung voraus, der sich Köhler - wie der Krott zeigt - mit Hingabe unterzog. Offenbar wuchs Köhlers künstlerische Intention bald über den unmittelbaren Anlaß und Auftrag weit hinaus. Der "Poet" bemächtigt sich des spröden Stoffs und versucht, ihn durch sensible sprachliche Behandlung geschmeidig zu machen, zum Beispiel durch Wortreihungen und Lautmalerei ("geht Kohle, roh, braun, erdig, feucht, von der Kippe über Brecher, Bunker, Bandverteiler, durch Mühlen, Feuer, Filter, in graue Asche über" (22) oder "alle wichtigen Wege, Stege, Steige, Bahnen, Bühnen, Pulte, Rampen, Durchfahrten, Brücken, Trassen laufen . . ." [S. 21]). Im Miteinander verschiedenartiger Darstellungsmittel ist das erzählerische Element das übergreifende. Das direkt Operative, das Authentische über Energieerzeugung ist in einem höheren, einem fiktiven Erzählzusammenhang im mehrfachen Wortsinn "aufgehoben". Ihn konstituieren sehr unterschiedliche Elemente: Phantastisches, Dokumentarisches, Satirisch-Komisches, Sprachkritik, Motive und Symbole. Es ist durchaus vorstellbar, daß der Auftrag für eine operative Darstellung Köhler hätte veranlassen können, auf Fabelmuster zurückzugreifen, die vielen "Betriebs- und Produktionsromanen" zugrunde lagen (Chronik eines Werksaufbaus, Überwindung von Mängeln und Katastrophen, Einführung arbeitsorganisatorischer, technologischer Neuerungen usw). Und tatsächlich schimmert ein solches Wirklichkeitsproblem in Köhlers Buch durch: Am Ort des Geschehens, in einem neuerbauten Kraftwerk, herrscht größte Unruhe, weil der Minister bei seinem Besuch schlimme Mängel gerügt und grundsätzliche Veränderung der Lage gefordert hat. Aber das bildet nicht die Handlung selbst, sondern nur ihr auslösendes Element. Ihr Gegenstand ist nicht die Veränderung, sondern die Analyse der dafür notwendigen geistigen Voraussetzungen.
Bereits die ersten Sätze stimmen darauf ein, daß es im Buch sehr "philosophisch" zugehen wird. “Den Wecker rasseln hören, wissen, was der Tag verlangt, hingehen, entsprechen; sachlich, kundig, wirksam; ach was." (S. 7) Erst das verblüffende "ach was" am Ende der merkwürdigen Infinitiv- und Adjektivreihe läßt erkennen, daß sich hinter dem unpersönlich anmutenden Denkvorgang ein menschliches Wesen verbirgt, das eines schönen Morgens auf menschliche, allzu menschliche Weise reagiert. Ein Ich schiebt mit dem Weckerrasseln weg, "was der Tag verlangt" (S. 7), und spinnt noch ein Weilchen an seinem schönen Traum vom "Garten Eden", in dem "Milch und Honig fließen" (S. 12) und die Menschen in vollendeter Harmonie mit der Tierwelt leben. Der Träumende entpuppt sich dann als der Gewerkschafts- und Kulturfunktionär Paul Jordan, der wegen seiner Flucht in den Traum verschläft und so den Ministerbesuch, die Auseinandersetzung mit der "Forderung des T ages" versäumt. Und nun erzählt Köhler, wie die Wirklichkeit den immer weiter flüchtenden Paul Jordan auf phantastische Weise einholt. Er wird von einem egelähnlichen Wesen, dem Krott, befallen. Es "alarmiert nach innen und verschärft das Zustandsbewußtsein gegenüber außen" (S. 93); es verhilft zu Erkenntnissen, die die tiefsten Ursachen der mit allgemeinen Worten gerügten Mängel erhellen. Und so wie am Anfang der Erzählung der Aufeinanderprall von Utopie und harter Tageswirklichkeit den Helden in Bedrängnis bringt, bestimmen diese beiden Pole die Handlungsführung bis zum Ende. Auf der einen Seite macht Jordan immer neue und nicht wenig erschreckende Erfahrungen mit der ihn umgebenden Wirklichkeit, und auf der anderen muß er sich mit verschiedenartigen Utopieangeboten auseinandersetzen. Das ergibt, vor allem auch zwischen den Zeilen, vielerlei bedeutungsschwere Beziehungen, die einiges darüber aussagen, wie man vom gegebenen, mit vielen Mängeln behafteten Zustand zu den besseren und schöneren Gesellschaftszuständen kommt, von denen sich so leicht träumen läßt. Solch ein "Untertext", den sich der Leser freilich selbständig erarbeiten muß, ergibt sich zum Beispiel, wenn er Paul Jordans ersten mit seinem letzten Traum vergleicht. Sah sich das träumende Subjekt am Anfang als staunenden Betrachter einer fertigen Paradieswelt, so erlebt es sich nun als ein schöpferisch Tätiger, der eine vernünftige, sinnvolle Welt schafft, indem er sich mit den Forderungen des Tages abmüht. Von diesem Zusammenhang her ergibt sich auch die Verbindung zu den im Kapitel "IK-KI" erörterten Problemen, die sich zunächst wie ein Fremdkörper ausnehmen. Erst als Jordan den Sinn schöpferischer Tätigkeit begreift, hat er auch die Fähigkeit, seiner altklugen Tochter Vision von einem modernen, "sozialistischen" kategorischen Imperativ beizukommen. Am Ende ist jenes wundersame Elixier gefunden, das Jordan "mit mächtiger Kelle" in sein kybernetisches System-Modell schöpft. Er nennt es "Sinnerfüllung . . ., Hochgefühl des bewußten Seins, ständig gegenwärtige, handlungsumschlossene Anschauung der Natur und aller eigenen Schritte darin" (S. 132). Mit solchen abstrakten Wendungen und den in verschiedenen Kontexten auftauchenden Begriffen Initiative, Produktivität und Schöpferkraft ist in etwa umschrieben, was als der geheime Held des Buches gelten kann.
Das Buch ist unterwegs, jene Hemmnisse bloßzulegen, die die Initiative, Produktivität und Schöpferkraft lähmen. Es entdeckt sie in mancherlei Gestalt und nicht zuletzt in den Schlupfwinkeln der Sprachverhunzung, wenn in einer meisterhaft gestalteten "schulmäßigen" Satzanalyse nachgewiesen wird, wie die Initiative in die "Leideform" (S. 61) gerät. Jordan sucht auch deshalb so leidenschaftlich nach einer besonderen Triebkraft, weil ihm die bekannten materiellen Stimuli, da er sich gerade mit der Verteilung von PKW zu beschäftigen hat, verdächtig sind. Kurz bevor ihn der Krott befiel, meditierte Jordan trübsinnig: "Wir, mit ... diesen Sofort-, Quartals-, Jahres-, Jubiläums-, Schwerpunkt-, Erfolgs-, Treue-, Wissenschafts-, Qualifizierungs-, Sauberkeits-, Pünktlichkeits-, Anwesenheits-, Ordnungs-, Sonder- und Selbstverständlichkeitsprämien? Wer soll da wen erheben? Die Herzen hebeln wir uns in die Brieftaschen. So wird der Mensch nicht Schöpfer, schafft er sich höchstens." (S. 27) Im Laufe der Handlung treibt Köhler Jordans Abneigung gegen alle Konsum- und Besitzideologie auf die Spitze und läßt ihn von der Abschaffung des Geldes träumen. Mit Geld scheinen ihm jene schönen Zustände unmöglich, in denen sich der Mensch nicht am Verbrauch, sondern am "Hervorbringen" (S. 119) mißt und wo ihm "Anschauung" (S. 132) mehr gilt als Aneignung. Köhler diskutiert auf solche Weise Probleme des Kommunismus, vermeidet jedoch den Gebrauch des Terminus in besonders auffälliger Weise. Jordan schreckt vor diesem Wort zurück, als er Zukunftsvisionen spinnt. Es erregt ihn zu stark. Zugleich wird ihm dabei klar, daß das letzte Stadium der Krott-Seuche eingetreten ist, und er rettet sich in den Hammerschlag des jungen Arbeiters, von dem er sich in seinen geheimsten Gedanken wohl verstanden weiß. Am Ende des Buches steht die Entdeckung, daß es nicht bei der Alternative von utopischen Träumereien einerseits und geistloser Geld- und Prämienschinderei bleiben muß, wenn ein Lebensprinzip herrscht, in dem der Sinn allen Tuns immer zugleich als Zweck und Mittel begreiflich wird. Es geht um die annäherungsweise Formulierung einer Lebenshaltung, die befähigt, "aus dem stetigen Widerspruch zwischen dem Materiellen und dem Ideellen neue progressive Impulse zu gewinnen" (23). Nehmen sich die positiven Bestimmungen etwas abstrakt aus - als Gedankengebilde einer Figur ist dies in gewisser Weise künstlerisch motiviert -, so erscheinen alle die Produktivitätsentfaltung hemmenden Faktoren um so plastischer, sicherlich auch deshalb, weil der Leser dabei ständig Bekanntes wiedererkennt und weil Köhler sich ausgiebig des Satirisch-Komischen bedient. Das betrifft sowohl Mängel im Produktionsgeschehen, die der ahnungslose Kulturfunktionär auf seinen Gängen durch die "Höhen" und "Tiefen" seines Betriebes (in den Kapiteln "BMSR", "ZRB" und "Kondensation") entdeckt. Seine Auffassung vom notwendigen Zusammenhang zwischen der Größe einer Sache und der Schönheit ihres sprachlichen Ausdrucks legt er in einer humoristischen Wendung Jordans Frau, einer engagierten Deutschlehrerin, in den Mund: "Große und richtige Gedanken müssen schlicht und schön gesagt werden. Mut und Freude müssen sie verbreiten: 'Seht, das haben wir uns vorgenommen.'" (S. 40)
Von hier aus führt recht ironisch ein Zusammenhang zu dem, auch in dieses Werk eingebauten, Künstler. Paul Jordan beauftragt einen Schriftsteller mit der stilistischen (!) Überarbeitung neuer Betriebsdokumente. Diesem Künstlertyp, der diesmal jeden sentimentalen Zug abgestreift hat und etwas satyrhaft aufgemacht auftritt, obliegt zugleich das ernsthafte Amt, eine im Stenogrammstil abgefaßte Poetik vorzutragen. Danach erscheint es als wünschenswert, sich völlig von "naturaler Schreibweise" (S. 79) frei zu machen und zu einer vertieft realistischen Schreibweise zu kommen, in der sich alle Elemente eines Werks in der Weise "beDINGen" (S. 79), daß ein ganzheitlicher, von innen heraus lebender Organismus entsteht. Damit ist formuliert, was im Krott schon zum Teil verwirklicht ist, im übrigen aber als Zielvorstellung darüber hinausweist.
Der Roman Hinter den Bergen wurde nach Beendigung des Krott geschrieben. Dadurch, daß beide Werke fast zum gleichen Zeitpunkt - 1976 - erschienen, wirkte der Unterschied der Erzählweisen sehr auffällig. Besteht die Eigenart des Krott in seiner genrehaften Gemischtheit, in seiner Gedrungenheit und novellistischen Zuspitzung, so ist für Hinter den Bergen die episch breite Anlage charakteristisch. Gelassen fließt der Strom der Erzählung von Begebenheit zu Begebenheit. Am Ende sind dreißig Jahre vergangen. Inzwischen haben sich zahlreiche, unterschiedlichste Lebensschicksale erfüllt, und vor unseren Augen vollzog sich die vollständige Veränderung eines ganzen Dorfes: Ähnlich wie andere Werke Köhlers setzt sich dieses auf großräumige Entwicklungen angelegte Buch aus sehr verschiedenartigen Themenkomplexen und Sujetelementen zusammen..Da ist zunächst die Grundidee des Romans, einen abgeschiedenen Raum "hinter den Bergen", eine "heckenumfriedete Spielwiese. . . für Lebensexperimente" (24) zu schaffen, um verschiedene Varianten von Arbeits- und Lebensweise - darunter auch eine utopisch- kommunistische - durchzuspielen. Dieser Handlungskomplex ist vor allem an die Figur des Laienpredigers Rufeland gebunden. Weiterhin fällt auf, daß sich im Roman all das als eine besondere Sphäre herauskristallisiert, was mit dem Chronisten und Maler Ahnfeld zu tun hat; wiederum ist also die Kunst mit ihren verschiedenartigen Funktionen Gegenstand der Darstellung. Und schließlich hat alles Geschehen, auch Rufelands und Ahnfelds Wirken, seinen Bezugspunkt zur Figur der Alma Teutschke mit ihren sechs unehelichen Kindern. Diese drei Grundelemente des Buchs sind derart vielfältig aufeinander bezogen, daß sie sich echt bedingen. Durch wechselseitige Beleuchtung entstehen reiche Assoziations- und Aussagefelder, die den Wortlaut des Textes weiterzudenken erlauben beziehungsweise fordern. Besonderes Interesse zieht die Gestaltung der Alma Teutschke auf sich. Mit ihr gelang dem Autor eine Figur, die sehr real wirkt und zugleich stark poetisch überhöht ist. In seinem Roman gibt der Erzähler ironisch gefärbte Winke, wie das Verhältnis von literarischer Figur und Wirklichkeit zu verstehen sei. Da heißt es zum Beispiel: "Wer hätte noch nichts von jenen alleinstehenden Müttern mit ihrem sprichwörtlichen halben Dutzend unehelichen Kindern vernommen, . . . wir sind gewillt, das magische halbe Dutzend ehelos geborener Geschöpfe, mag die Wirklichkeit auch im Durchschnitt um einen oder zwei Zähler drüber oder drunter liegen, mit unserer Heldin durchzuexerzieren." (S. 288)
Solche kommentierenden Einschaltungen durchbrechen die Fiktion einer in sich geschlossenen Romanwelt und stellen einen direkten Bezug zur wirklichen Welt her, allerdings nicht im Sinne eines einfachen Gleichheitszeichens, sondern im Sinne einer Aufforderung an den Leser, auf Grund eigener Erfahrungen zu urteilen, in welcher Weise Alma Teutschkes Geschick für unser Leben charakteristisch sei. Solches Verfahren hat auch mit Eulenspiegelei zu tun, allerdings nicht im Sinne schwankhafter Witzelei, sondern im Sinne der Bemühung um tragisch-komische Mischungen, um ein differenziertes Miteinander von Sympathie und Kritik. Im Ganzen wie im Detail zielt die Gestaltung des Romans nicht auf das karge mechanistische Entweder-Oder, sondern auf den dialektischen Reichtum der Aspekte. So ist in Alma Teutschke sowohl das besondere Problem der unehelichen Mutter als auch der gesellschaftlichen Rolle der Frau generell enthalten. Diese Alma konnte unter anderem deshalb so gut gelingen, weil ihr Schicksal tief in den gesellschaftlichen, in den konkret historischen Kontext eingebettet wurde. Ihr geschieht auf besondere Weise, was vielen geschieht. Rufeland zum Beispiel, der Gründer des Ruhiner Musterstaats, stößt bei der Suche nach den Ursachen seines Scheiterns darauf, daß man den Frauen im sozialen Mechanismus des Dorfes keine "tätigen Funktionen" (S. 218) zugewiesen, sondern daß man sie mit schönen Worten abgespeist und über ihre passive Rolle in der Männergesellschaft hinweggetröstet hatte. Diese scharfe Selbstkritik einer Romanfigur bringt zu Bewußtsein, daß Köhler in früheren Werken die unentwickelte Stellung der Frauen als Problem der Gestaltung einfach übersehen hatte. In Schatzsucher hatte er, ohne zu stutzen, jene Männergesellschaft naiv reproduziert, die er in der Wirklichkeit vorfand. Um so entschiedener fällt später - das beginnt mit Geist von Cranitz - die Korrektur aus. Damit sind nicht einzelne scharfe Sentenzen gemeint, sondern letztlich die Grundkonzeption des Werks, eine Frau in den Mittelpunkt zu stellen und an ihrem Schicksal den menschlichen Zweck allen Tuns zu messen. Warum nur die vielen unehelichen Kinder? Für den Autor ist das in mancher Hinsicht vorteilhaft. Indem er Almas und ihrer Kinder - und auch deren Väter! - Geschichte verfolgt, baut er sich ein Romangerüst, das eine zeitlich so ausgedehnte Handlung zu tragen vermag. Überhaupt ist die Idee, eine uneheliche Mutter in einem kleinen Dorf anzusiedeln, überaus "geschichtenträchtig". Die Möglichkeiten dieses Sujets haben vor Köhler auch andere DDR-Autoren (darunter Siegfried Pfaff in Regina B. und Wolfgang Kohlhaase in Lasset die Kindlein) erkannt und genutzt.
Anfangs, als sie ihre ersten Kinder empfängt, ist Alma vor allem Objekt des Geschehens. Später legt sie es bewußt darauf an, von dem Mann, den sie liebt ein Kind zu,bekommen. Und wieder später weist sie mehrere Männer, die sie ernsthaft lieben und heiraten wollen, um ihrer Selbständigkeit und Unabhängigkeit willen zurück. Und dieser im Laufe der Zeit gewonnene Spielraum von Entscheidungsfreiheit im Privaten sichert ihr im öffentlichen Leben Ruhins die Chance, zuweilen als Subjekt der Verhältnisse zu agieren. Im Unterschied zu den verheirateten Frauen des Dorfes, die alles Verfügungsrecht an die Ehemänner abgetreten haben, übt Alma, zum Beispiel in bezug auf ihren Bodenanteil, effektive Mitsprache - was sie unter anderm in die Gefahr bringt gelyncht zu werden. Insgesamt aber fällt die Bilanz am Ende bitter aus. Almas Lebensanspruch war einseitig auf ihre Mutterrolle, ihre biologische Fortpflanzungsfunktion beschränkt. Sie selbst konnte sich nicht als Zweck setzen; sie konnte nichts aus sich machen. Sicherlich nicht nur im Urteil ihrer Tochter Astra gilt dies als ein anachronistisches, den humanen Zweck verfehlende Leben. Astra will sinnerfüllt arbeiten, etwas leisten und im übrigen "soviel Kinder haben, wie mein Verstand mir erlaubt und nicht mein Bauch es kann” (S. 453). Köhler zeigt deutlich, daß auch Alma dieses Leben nicht als Ideal sieht, wenn er von ihren geheimen Träumen von wissenschaftlicher Beschäftigung mit den Sternen erzählt. Und nur der Name der Tochter Astra bleibt als reales Ergebnis dieser hochfliegenden Sehnsüchte. Während Alma dem Orte Ruhin unaufhörlich gibt - Kinder, Boden, Arbeitskraft -, profitiert sie dagegen wenig, und zwar in den verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungsphasen gleichermaßen. So fordert dieses Frauenschicksal die Überlegung heraus, in welchem Maße derartiges heute der Vergangenheit angehört. Das Nachdenken über diese Figur wird vom Autor auch dadurch stimuliert, daß er ihr extrem gegensätzliche Attribute mitgibt. Einerseits gilt sie - durch Rufelands und Ahnfelds Art, sie der Mitwelt zu präsentieren - als heilige Jungfrau und andererseits als Hexe und Hure. In der öffentlichen Meinung schwankt und schillert ihr Bild entsprechend den Interessen und Auffassungen der Urteilenden. Köhlers Kunstgriff, Alma mit diesen bildhaften und stark wertenden Attributen auszustatten, die zugleich das Höchste und das Niedrigste meinen, verrät Spaß am Paradoxon (25), und zwar in einem sehr tiefen Sinn. Eine Frau gleichzeitig als Heilige und als Hure zu sehen ist schließlich keine literarische Erfindung, sondern eine nicht gar so seltene Erscheinung des wirklichen Lebens. Und sie bezieht sich auch nicht nur auf uneheliche Mütter. Köhler macht mit Almas Schicksal deutlich, inwiefern die mit der Verhimmelung der Frau Hand in Hand gehende Verteufelung den Mann daran hindert, die Frau als Menschen wahrzunehmen. Alma aber steht als Mensch vor uns, der gleichermaßen zu lieben und zu kritisieren, zu bedauern und zu bewundern ist - ein sehr poetisches irdisches Wesen.
Im Zusammenhang mit der Geschichte Almas wird auch die Geschichte einer Kommune erzählt. Sie ist in einem Dorfe Ruhin (auch lesbar als Ruin/Ruine, Ruh-in, Ruh-hin) angesiedelt. Diese Geschichte, die von der Begründung bis zur Auflösung der Kommune reicht, ist sehr vergnüglich zu lesen. Es ist der Spaß am Durchspielen von sozialen Experimenten, die besonders wegen ihres kommunistischen Gedankenelements unser Interesse erregen. Es mag verwirren, daß die Kommune (Kommunistisches sind wir als Zukünftiges zu denken gewohnt) vom Romanautor in die Anfänge der DDR-Geschichte verlegt wurde. -. In Alfred Wellms Roman Pugowitza oder die silberne Schlüsseluhr und schon früher in Peter Hacks' Stück Moritz Tassow gab es übrigens ganz ähnliche Konstellationen. - Die Kommune steht am Anfang einer Romanhandlung, die insgesamt von 1945 bis 1975 reicht. Weit entfernt, einen historischen Bilderbogen über dreißig Jahre sozialistischer Landwirtschaftsentwicklung in der DDR zu verfertigen, bedient sich Köhler bestimmter historischer Voraussetzungen, um sein Kommuneexperiment in Gang zu bringen. Es sind Verhältnisse großer materieller Not, der Obdachlosigkeit und geistigen Ratlosigkeit. Auf diesem Boden kann Rufelands naiver Gleichheitskommunismus eine Zeitlang gut gedeihen. Auf der Grundlage der allgemeinen - "hinter" wie "vor" den Bergen anzutreffenden - Not profitieren alle Beteiligten aus der gleichmäßigen Verteilung der Armut. Rufeland organisiert den Mitgliedern seiner abgeschiedenen Gemeinde die handgreifliche Erfahrung, daß Eigennutz durch Gemeinnutz entsteht, daß die gemeinschaftliche und gleiche Art zu arbeiten und zu konsumieren für jeden vorteilhaft ist.
Als strenger Realist zeigt Köhler, daß all dies nur so lange funktioniert, wie den Ruhinern unbekannt bleibt, daß man inzwischen Vor-den-Bergen mit weit weniger Arbeitszeit bei unterschiedlicher Leistung und Entlohnung zu persönlichem Wohlstand und Komfort kommen kann. Dem Sog des Prinzips "Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Leistungen" kann Rufeland auf die Dauer nichts entgegensetzen. Seine ideale Bruderschaft beruht auf der Voraussetzung eines allgemein niedrigen Lebensniveaus, das lediglich die Befriedigung der einfachsten Lebensbedürfnisse zuläßt. Das erklärt auch, warum die Ruhiner durch das Kommune-Leben so wenig "gewandelt" und für das "Geistige" gewonnen wurden. Mit fliegenden Fahnen laufen sie zu dem anderen Prinzip über, das ihnen reiche materielle Güter verspricht. Köhler motiviert sehr fein, warum Rufelands Experiment in hohem Maße der Autorität des Glaubens und Wunders, der "gemischten" Mittel (S. 44) bedarf. Seine Stärke ist zugleich auch seine Schwäche. Alma und ihr Sohn Hans begründen Rufelands Glaubensgebäude und zersetzen es ebenso. An Alma und Sohn Hans wird gezeigt, wie sehr es sich rächt, den Menschen von seinem natürlichen leiblichen Wesen abziehen und einseitig auf das Geistige reduzieren zu wollen. Rufelands Eifern gegen die unsittliche materialistische Denkart wird von seinen beiden Kronzeugen,und von allen anderen Anhängern schlagend widerlegt. Alma eignet sich nicht als Glaubensidol; sie bekommt ein Kind nach dem anderen. Und ihr Sohn Hans, der, von Rufeland zum neuen Messias bestimmt, unter Ahnfelds Einfluß nicht nur die Bibel, sondern auch das Eulenspiegelbuch geleser hatte, manipuliert die biblischen Worte von Brot, Leib und Fleisch in so ketzerischer Weise, daß der entsetzten Gemeinde nahegelegt wird, das heilige Abendmahl nicht im übertragenen Sinne, sondern ganz direkt als fromme Menschenfresserei aufzufassen. Solche Direktheiten hält der Glaube nicht aus; er ist auf die Metapher angewiesen. Und damit kommt Rufelands utopische Gebäude auch von seinen "geistigen" Voraussetzungen her ins Wanken. Auffallend ist, daß Rufelands Musterstaat, trotz der logischen und praktischen Widerlegung, die der Autor vorführt, auch nach seinem Scheitern viel von seiner Ausstrahlung bewahrt. Manches erscheint um so schöner und wertvoller je weiter man sich davon entfernt. Es ging etwas verloren, was der in Ruhin seitdem erreichte Fortschritt nicht aufwiegt. Dieses Defizit, durchaus als bestimmte Lebensfakten benennbar, teilt sich dem Leser vor allem als Stimmung und ästhetischer Eindruck mit: es war schön. Ein Gleiches ist kaum von der Lebensform Ruhins zu sagen, die sich nach dem Scheitern Rufelands entwickelt. Woran liegt es, daß die "zeitgemäßen" und "auf starke Bewegungen ge gründeten Entwürfe" (S. 407) poetisch weniger reizvoll erscheinen als die Geschehnisse der ersten Romanhälfte, die so großartig einprägsame Episoden (zum Beispiel die Geburt Hans Teutschkes, seine Predigt, Rufelands Besichtigung der Ahnfeldschen Bilder) enthält? Liegt es daran, daß die kleinen und "verteilten Talente" (S. 407), die die spätere Entwicklung Ruhins bestimmen, die Einbildungskraft des Autors weniger inspirierten? Es kommen sicherlich mehrere Ursachen zusammen. Eine mag in folgendem Widerspruch liegen: Rufelands Idealstaat widerspricht vielen Vernunftsargumenten, und dennoch sind die Sympathien, die Gefühle stark auf seiner Seite. Umgekehrt wirkt die perfekt funktionierende Vernunftwelt in ihrer prosaischen Nüchternheit und Zweckmäßigkeit emotional wenig anziehend. Liegt darin nicht eine auffallende Parallele zur Lebensordnung jener "Unirdischen", von der Anna Seghers in ihren Sagen von Unirdischen berichtet? Ein Indiz für die Einseitigkeit jener so wohleingerichteten Welt, in der jede Bewegung verebbte, ist - bei Seghers und Köhler - das Fehlen der Kunst. In das utopische Gemeinwesen waren Kunst und Poesie leicht integrierbar. Das zeigen der - nie fertiggestellte - Kirchenbau und die religiöse Motive recht freizügig variierenden Kirchenfenster des Malers Ahnfeld, die das Geschehene deuten und das Künftige voraussagen. Im späteren Ruhin bzw. Teutschkendorf gibt es keinen Ahnfeld mehr. Und seine aussagekräftigen, aus wenig dauerhaftem Material gefertigten Bilder werden durch rein dekorative, nichtssagende und dauerhafte Beton-Glas-Mosaike ersetzt.
Nicht nur Rufelands Kommune, auch das andere Ruhin, das mit den Lebensprinzipien von Vor-den-Bergen sehr viel mehr zu tun hat als die gescheiterte utopische Variante, ist Erfindung, ausgestellt dem kritischen Vergleich, ob man so lebe bzw. so leben wolle. In gewisser Weise sind Ruhins Verhältnisse, so wie sie von Almas Kindern maßgeblich geprägt werden, sozial vorbildlich, geradezu ideal. Alle arbeiten ruhig, in sinnvoller Arbeitsteilung untereinander und mit dem übrigen Lande vor den Bergen. Aber schließlich sind es Zustände, die von Pragmatikern und "Beschaffern" wie Bolle-Baal (S. 375) geschaffen wurden. Hier gibt es nicht die schwarze Lilie, jenes von Rufeland beschworene Symbol für den "Zustand andauernder Hochkultur" (S. 179), für das endgültige "Zeitalter der Vernunft, der Liebe und der Poesie" (S. 447). Ob und inwiefern die geschilderten Zustände denen gleichkommen, in denen wir heute leben, das mag jeder Leser aus seiner eigenen Lebenserfahrung beurteilen. Solches Vergleichen und Urteilen regt an, über Notwendigkeiten und Möglichkeiten sozialistisch-kommunistischer Entwicklung erneut und tiefer nachzudenken.
Die Unterschiede in der Lebensweise und Lebensstimmung der beiden Etappen in der Ruhiner Entwicklung, die sich mit den Begriffen poetisch und prosaisch grob umschreiben lassen, bedingten auch beträchtliche Unterschiede in der Gestaltungsweise. Der Erzähler verkündet zu Beginn des 3. Buches, daß er nunmehr die Ironie (S. 260) verstärkt zur Hilfe nehmen wolle. Und sie hilft in der Tat sehr, die Erscheinungen und Vorgänge in der zweckmäßig und nüchtern organisierten Welt des späteren Ruhin anschaulich zu machen. Die Ironie ist vor allem auch dazu nützlich, den Leser ständig leise daran zu erinnern, daß die erzählten Begebenheiten und Zustände etwas vom Künstler Erfundenes und Gemachtes darstellen, daß sie zwar mit dem Wirklichen viel zu tun haben, aber nicht mit ihm identisch sind. Schließlich wird auch im zweiten Romanteil etwas "durchgespielt" und zum Vergleich (26) ausgestellt, auch wenn das Dargestellte unserem heutigen Leben viel näher ist als das Kommune-Experiment.
Der Schöpfer von Ruhin erweist sich als ein sehr unruhiger Denker und Gestalter. Ihn beunruhigen die großen Fragen unseres Lebens, unserer Gegenwart und Zukunft. Und er hat sich die künstlerischen Mittel erarbeitet, um mit seiner eigenen Unruhe Leser in Bewegung zu setzen. Das Wie und Was seines Erzählens hat sich in den zurückliegenden zwanzig Jahren stark verändert. Und es ist schön, zu wissen, daß da noch nichts zum Stillstand gekommen ist, daß von diesem Schriftsteller noch manche Überraschungen und Entdeckungen zu gewärtigen sind.
Anmerkungen:
1 Außerdem erschienen noch die Geschichte Gespensterwald von Alt-Zauche in dem Saragossameer, Berlin 1976.
zurück zum Text
2 Karin Hirdina: Zukunft heißt Kommunismus, in: Sinn und Form, 2/1978, S. 451"
zurück zum Text
3 Erich Köhler: Reiten auf dem Leben, in: Erkenntnisse und Bekenntnisse, Halle 1964, S. 163. Die unmittelbar folgenden Seitenangaben im fortlaufenden Text beziehen sich auf diesen Band.
zurück zum Text
4 So meditiert beispielsweise der Ich-Erzähler der Rahmenhandlung, als der ehemalige Majorsbursche - zum Zwecke dieses verallgemeinernden Einschubs - seine Rede unterbricht: "Das Pferd ist Kamerad und bleibt es, ob Krieg oder Frieden. Es kann seine Einstellung zum Menschen nicht ändern. Der Mensch aber kann es" Er kann die Kraft des Pferdes im Kriege mißbrauchen. Er kann sie sich zunutze machen, um fruchtbaren Acker zu bestellen. Bei uns sind die Pferde schon vielfach durch die Maschinen unserer MTS entlastet. Heute brauchen unsere Tiere kaum halb so schwer zu arbeiten wie etwa zu Anfang unseres ersten Fünfjahrplanes; aber sie sind uns immer noch unentbehrliche und treue Helfer im Aufbau unseres Landwirtschaftsbetriebes. - Ich kehrte von meinem Gedankengang wieder zu Ott zurück, der jetzt weitererzählte:..." (Erich Köhler: Das Pferd und sein Herr, in: Köhler: Nils Harland, Rostock 1968, S. 105f.)
zurück zum Text
5 Auf mangelnde Schreiberfahrung ist beispielsweise zurückzuführen, daß Köhler sich durch das Interesse für bestimmte Figuren und Probleme so weit hinreißen läßt, daß sie sich - wie die Rivalitätskämpfe des Majors Rottmann mit anderen Offizieren - verselbständigen und ihr Zusammenhang mit dem Sujet von “Pferd und Herr” aus dem Auge verloren wird, oder daß er die verschiedenen Möglichkeiten der Erzählperspektive nicht beherrscht und den Standpunkt des allwissenden Erzählers und figurengebundenes Erzählen unfreiwillig durcheinanderbringt, plötzlich selbst darüber stutzt und umständlich Aufklärung gibt, warum eine Figur unversehens wie ein allwissender Erzähler operiert hatte, zum Beispiel S. 125.
zurück zum Text
6 Erich Köhler: Aus dem Marnitzer Tagebuch, in: NDL, 4/1960, S. 72.
zurück zum Text
7 Eva Strittmatter: Notizen, in: NDL, 4/1960, S. 76.
8 Ebd., S. 76.
9 Ebd.
zurück zum Text
10 Erich Köhler: Reiten auf dem Leben, a. a. O., S. 182.
zurück zum Text
11 Erich Köhler: Über die Scholochow-Resonanz in meiner Erzählung 'Schatzsucher', in: Michail Scholochow - Werk und Wirkung, Sammelband, Leipzig 1966, S. 272 f.
zurück zum Text
12 Da Karin Hirdina in ihrem Artikel die Problemlinie des utopischen Entwurfs in Köhlers Hauptwerken kräftig herausgearbeitet hat und meine Auffassungen sich mit ihren im wesentlichen decken, verzichte ich auf ausführliche Darlegungen zu diesem Problemzusammenhang und verweise auf Karin Hirdinas Überlegungen.
-> zurück zum Text
13 Durch seine Uneigennützigkeit ist Ramm mit dem ein Jahr früher auf der literarischen Bühne erscheinenden “Ole Bienkopp” brüderlich verwandt, zum Teil auch in der Eigenbrötelei und Unfähigkeit, sich Bundesgenossen zu gewinnen, - wobei Strittmatter diese Eigenschaften aus einem anderen sozialen Hintergrund herleitet und in einer anders gelagerten politisch-moralischen Kräftegruppierung ausspielt.
zurück zum Text
14 Erich Köhler: Über die Scholochow-Resonanz. . ., a. a. O., S. 274.
zurück zum Text
15 Erich Köhler: Schatzsucher, Rostock 1964, S. 240.
zurück zum Text
16 Ebd., S. 241.
zurück zum Text
17 Erich Köhler: Über die Scholochow-Resonanz. . ., a. a. O., S. 272.
zurück zum Text
18 Ebd.
zurück zum Text
19 Beispielsweise in dem 1975 erschienenen Kinderbuch Der Schlangenkönig, dem man übrigens die im Interview (vgl. “Sinn und Form”, 4/1978) geschilderten Komplikationen während der Entstehungsgeschichte kaum anmerkt. Eine gesonderte Untersuchung der Kinderbücher und Kinderstücke kann hier nicht geleistet, nur dringend angeregt werden.
zurück zum Text
20 Sinn und Form, 6/1968, S. 1517 (Anmerkungen).
zurück zum Text
21 " .. oder das Ding unterm Hut" ist ein vom Verlag vorgeschlagener Zusatz, der Köhlers Intention wenig entspricht.
zurück zum Text
22 Erich Köhler: Der Krott oder Das Ding unterm Hut, Rostock 1976, S. 20. Die unmittelbar folgenden Seitenangaben im fortlaufenden Text beziehen sich auf diesen Band.
zurück zum Text
23 Eva Kaufmann: Interview mit Erich Köhler, in: Sinn und Form, 4/1978, S. 753.
zurück zum Text
24 Erich Köhler: Hinter den Bergen, Rostock 1967, S. 446. Die unmittelbar folgenden Seitenangaben im fortlaufenden Text beziehen sich auf diesen Band.
zurück zum Text
25 Als ein tiefsinniges Paradoxon kann auch Hans Teutschkes Geschichte gelten, der, zum Messias bestimmt und erzogen, ein Gemeinwesen durch eulenspiegelhafte Reden in Verwirrung bringt und diesem später als ABV zugeteilt wird. Was werden da für gedankliche Zusammenhänge möglich: Jesus und Eulenspiegel erscheinen als zwei "Helden" (S. 205), die bei dem Versuch, eine rechte Lebensordnung zu schaffen, in Lebensgefahr gerieten. Wegen solch scharfsinniger Analyse hielt es Hänschen geraten, schleunigst davonzulaufen. Auf Ahnfelds Bild steht Später Eulenspiegel-Hans "zum Ausfahren allzeit bereit ... in der Grube" (S. 246), während er in Wirklichkeit als Angehöriger des Wachregiments auf Posten steht - unbeweglich und unansprechbar. Über das subjektve Glücks- oder Unglücksempfinden des ordnungschaffenden ABV gibt der Erzähler keine Auskunft" So ist Almas Sohn mit einem lachenden und einem weinenden Auge anzusehen.
zurück zum Text
26 Mehrfach, in verschiedenen Handlungskontexten, wird im Roman betont, daß Ruhin eigens zum Zwecke des Unterscheidens existiert. "Nur am Vergleich wird die Wahrheit einer Sache sichtbar" (Hinter den Bergen, S. 147), heißt es aus Rufelands Mund.
zurück zum Text