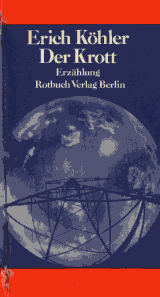"Geht es an, eine Zukunft ins Blickfeld zu rücken, deren Züge im einzelnen noch gar nicht klar sind und auf der andererseits bestanden wird? Auf einem jedenfalls besteht Köhler nachdrücklich: Zukunft heißt Kommunismus. Die Frage nach der Legitimität von Entwürfen dieser zukünftigen Gesellschaft, die auch utopische Momente enthalten, wäre zu simpel beantwortet, würden wir in solchen Entwürfen den unverbindlichen Spielplatz folgenloser Phantasie, schöner Wunschbilder in der Kunst sehen." (Karin Hirdina)
aus: SINN UND FORM 2. Heft (03/04) 1978
Zukunft heißt Kommunismus
von Karin Hirdina
Erich Köhler - ein Autor, um dessen Werke es keine großen Literaturdiskussionen gegeben hat, die unspektakulär den Buchhandel durchliefen, die besprochen wurden. Positiv im allgemeinen. Nichts Aufregendes? Zwei Romane liegen bisher vor: Schatzsucher (1964), Hinter den Bergen (1976). Ein Erzählungsband: Nils Harland (1968). Der Krott oder das Ding unterm Hut (1976). Theaterstücke. Kinderbücher. Nicht so wenig also, daß Quantität öffentliche Zurückhaltung erklären würde. Die Qualität also? Was schreibt Erich Köhler, worüber, wie? Fragen wir zunächst die Lexika. Die Auskünfte ähneln sich. Beispiel: Meyers Taschenlexikon Schriftsteller der DDR. Leipzig 1974.
Der Krott
oder Das Ding unterm Hut,
VEB Hinstorff Verlag Rostock 1976
Hinter den Bergen,
VEB Hinstorff Verlag Rostock 1976.
"Köhler, Erich, geb. 28.12.1928 Karlsbad, Erzähler. Sohn eines Porzellanschleifers, war nach nicht abgeschlossener Bäcker-, Schneider-, und Malerlehre u. a. Landarbeiter in Mecklenburg; er trampte durch Westdeutschland und Holland und kehrte 1950 in die DDR zurück; arbeitete bei der Wismut-AG unter Tage und ging wieder als Landarbeiter nach Mecklenburg; 1958/61 Studium am Institut für Literatur Johannes R. Becher` in Leipzig; lebt in Alt Zauche (Kr. Lübben); erhielt 1964 den Literaturpreis des FDGB. Im Zentrum des erzählerischen Werks von K. stehen Probleme, die aus der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft resultieren. Bereits seine erste Erzählung 'Das Pferd und sein Herr' (1956) - sie zeigt den Wandel der Menschen auf dem Lande und bezeugt die immer wieder anklingende Tierliebe K.s - machte auch durch ihre stilistische Formung nachdrücklich auf den Autor aufmerksam. In dem handlungsreichen Roman 'Schatzsucher' (1964) schildert K., aus reichen persönlichen Erfahrungen schöpfend und stets auf der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln, bildkräftig und originell den Kampf um neue Produktionsmethoden; lebendig und phantasievoll gezeichnete Genossenschaftsbauern mit ihren moralischen und politischen Konflikten beherrschen das Geschehen, in dem sich das Entstehen ländlicher Kooperationsgemeinschaften ankündigt. In dem symbolträchtigen Stück 'Der Geist von Cranitz' (U. 1972) versuchte K., teils mit grotesken Mitteln, teils in märchenhafter Gestalt, die gesellschaftliche Umwälzung auf dem Lande mit Problemen der Kulturrevolution in Verbindung zu bringen."
"Handlungsreich", "bildkräftig", "originell", "Probleme, die aus der sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft resultieren", "Tierliebe" - wird in diesen Attributen etwas von dem sichtbar, was Köhlers Werk ausmacht? Sie legen nahe, seine Erzählungen und Romane zu lesen als Chroniken und Illustrationen zur sozialistischen Umgestaltung der Landwirtschaft, zu den auf den verschiedenen Parteitagen formulierten Hauptaufgaben, zur Diskussion um Wesen und Perspektive des realen Sozialismus.
Dann wäre die relative Echolosigkeit der Erzählungen und Romane verständlich, denn Illustrationen regen nur selten auf oder an zu öffentlicher Verständigung. Man könnte Köhlers Werke so lesen - wenn sie nicht so gut und das heißt etwas ganz anderes wären. Für mich gehören sie - besonders "Hinter den Bergen" - zu den seltenen Werken, über die deshalb so schwer zu reden ist, weil sie so seltene Glücksfälle sind. Auf so selbstverständliche Weise gelungen und glücklich machend. Der sowjetische Film "Leuchte mein Stern, leuchte" war in den letzten Jahren ein besonders eindrucksvolles Beispiel für diese Glücksfälle. Fellinis "Amarcord" gehört dazu oder Wellms "Pugowitza". Es sind poetische Werke - "bildkräftig" sagt das Lexikon. Was aber heißt das für Köhlers Prosa? - Die Theaterstücke, vor allem "Der Geist von Cranitz", sollen im folgenden ausgeklammert bleiben, haben sie doch noch keine adäquate theatralische Verwirklichung gefunden. Der Geist dieser Stücke aber ist der gleiche wie der der Erzählungen und Romane. Ihm soll nachgegangen werden. Vielleicht läßt sich dann auch erklären, warum Köhler zu den "Stillen im Lande" gehört, zu denen, die nicht im Vordergrund literaturkritischer, öffentlicher Aufmerksamkeit stehen. Ich kenne Erich Köhler nicht, weiß nicht, ob ihn dieser Zustand berührt, kalt läßt oder beunruhigt, vielleicht schmerzt. Mich beunruhigt er, weist er doch darauf hin, daß wir nicht so genau wissen, wovon gegenwärtig öffentliche Resonanz von Büchern abhängt. Worüber reden Leute, wenn sie über Literatur reden? Vor allem wohl über sich selbst, über ihre Erfahrungen, Wunschbilder, Empfindlichkeiten, Ziele, über Verdrängtes auch. Alle Literaturdiskussionen weisen es aus - jüngst Annemarie Auers Pamphlet zu Christa Wolfs "Kindheitsmuster" (Sinn und Form, 4/1977). Unüberhörbar dabei: der Ton des Getroffenseins und der Wunsch, dies abzustreiten. Christa Wolfs Buch hat viele getroffen; andere Bücher, über die öffentlich gestritten wurde, hatten getroffen, was dann eingestanden oder auch bestritten wurde. Trifft Köhler uns nicht? Was also schreibt er?
Sein allgemeiner Gegenstand ist natürlich nicht die sozialistische Umgestaltung der Landwirtschaft, wohl aber die Lebensproblematik jener, die von der Umgestaltung dieser Gesellschaft betroffen waren, sie durchgeführt haben - mit unterschiedlichen Motiven und persönlichen Zielvorstellungen. Dies vor allem scheint mir sein Thema zu sein - wie gesellschaftlicher Fortschritt in unserer ureigensten Geschichte zustande kam und wie, woran er zu messen ist. Dieses Maß befragt Köhler in seinen Büchern in verschiedenen Motiven: im Verhältnis von Natur und industrialisierter Umwelt, im Motiv der Schatzsuche, des Eigentümerbewußtseins, materieller Stimuli, des entwickelten Konsums und Genusses, im Verhältnis von Kollektivität und Eigennutz. Diese Motive durchziehen - neben anderen - "Schatzsucher", "Krott", "Hinter den Bergen". Stofflich kommt neben der dörflichen Sphäre die Armee vor - je eine der Hauptfiguren in "Schatzsucher" und "Hinter den Bergen" meldet sich in den fünfziger Jahren freiwillig zum Dienst in der Armee -, und "Krott" schließlich ist in einem industriellen Großbetrieb, einem Kraftwerk, angesiedelt, das auf der Wiese entstand. Zentrales Motiv aber dieser drei Werke - wie schon ansatzweise in der früheren Erzählung "Nils Harland" - scheint mir das Gewicht des Utopischen in unseren Vorstellungen von der Zukunft zu sein. Nun haben wir uns im theoretischen Bewußtsein, dem programmatischen Titel von Engels: "Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft" folgend, längst daran gewöhnt, Utopie als etwas Suspektes anzusehen. Als vorwissenschaftliche und inadäquate Bewußtseinsform. Im alltäglichen Sprachgebrauch ist Utopisches so etwa dasselbe wie Illusionistisches oder auch einfach Unrealistisches. Welche Gehalte kann dann Köhler mit diesem Motiv überhaupt entfalten?
"Schatzsucher", "Der Krott" und "Hinter den Bergen" enthalten - jeweils verschieden deutlich ausgemalt, unterschiedlich auch mit dem erzählten Geschehen verknüpft - utopische Entwürfe. Entwürfe, denen eines gemeinsam ist. Sie meinen Kommunismus. Eine Gesellschaft, die vor allem durch "bargeldlose Leistung" (Erich Köhler) bestimmt ist, durch Harmonie zwischen Mensch und Natur, durch Abwesenheit von Egoismus.
Heinrich Ramm in "Schatzsucher" strebt nach der schnellen, möglichst sofortigen Überwindung privatistischen Denkens. Er versucht dies konsequent vorzuleben - verzichtet auf die private Nebenwirtschaft, bis seine Frau gegen seinen Willen die private Kuh in den privaten Stall einstellt. Ramm aber hält sein Ziel für real - jetzt sofort. Nur: Die Menschen um ihn stehen dem entgegen, sie sind "Schatzsucher", wollen die Bereicherung, das gute Leben, den guten Verdienst - bei guter Arbeit oder auch ohne sie. Statt des Ideals treibt sie das Geld. Deshalb wendet sich Ramm von ihnen ab. "Nein, ich habe mir diese Bauern ganz anders vorgestellt, ehrlicher, stärker, größer in allem, mannhafter selbst im Widerstand. Und nun dieser Kleinkram. Brauchst mir keine Predigt zu halten. Theoretisch ist mir alles klar. Aber das Herz, das macht nicht mit. Ich brauche nur einen zu sehen, wie es rechnet und tüftelt hinter seiner Stirn, da krampft sich bei mir alles zusammen."
Ja, theoretisch wissen wir das alle, seit wir Lenin gelesen haben - der Sozialismus wird aufgebaut mit den und durch die Menschen, die der Kapitalismus geformt hat. Also ist Ramm ein Spinner, einfach ein emotional Uneinsichtiger? Einer, der Realitätssinn durch utopisches Wollen ersetzt? Ein menschenverachtender Sonderling schließlich?
Antipode scheint der ihn als LPG-Vorsitzender ablösende Pflock zu sein" Die Namen: wie bei Strittmatter Kurzcharakteristik der Personen. Pflock, der stabile Realist, kein Träumer, der nach vorne prescht, einer, der das Nötige schrittweise anpackt - ob das Melkerproblem oder die Agitation in Langsbach.
Zwischen Ramm und Pflock steht der Instrukteur Eisenkolb, eisernes Büffelchen genannt, vermittelnd, zu Kompromissen bereit - auch mit dem Pfarrer -, wenn die Sache es erfordert, geschickt Ramms wie Pflocks Natur nutzend, ein wenig zu ausgewogen, weise und gut schon - was in Köhlers späteren Geschichten nicht mehr vorkommt. Eisenkolb weiß viel, er relativiert Extreme, vor allem die Rammschen: "Du suchst Gold, glaub's nur, reines Gold. Dieser edle Stoff kommt aber nur selten gediegen vor. Man muß ihn herauswaschen aus dem Sand, herausschmelzen aus dem Quarz, gewinnen aus Bergen tauben Gesteins. So ist das auch beim Menschen. So ein Körnchen Gold zu fördern, beim Menschen, du, das kostet Geduld und Arbeit" - Solche Art Lehrsätze werden in Köhlers späteren Werken nicht mehr stehen, und wenn doch, dann als ein Mittel ironischer Relativierung sich allwissend oder allzu weise gebender Personen. - Aber auch hier wird Köhlers wirklich dialektisches und gerechtes Erzählen bereits deutlich. So eindeutig, wie die Figuren eingeführt werden, bleiben sie nicht: Der anscheinend nur pragmatisch beharrende Pflock entwirft eine Konzeption beachtlicher Dimension für Kurzbach/Langsbach, die, klug angegangen, schließlich realisiert wird. "In einem weiteren Jahr, verstehst du, plagt sich kein Mensch mehr mit der individuellen Wirtschaft herum. Was Ramm, der Dussel, andauernd vom Menschen verlangt, dafür schaffen wir jetzt die Voraussetzung."
Ramm existiert schließlich mit der privaten Nebenwirtschaft, trinkt die Milch der privaten Kuh. Das Unausweichliche erreicht hinter seinem Rücken auch ihn. Und er, der menschenverachtende Ramm, malt das Porträt des Kommunisten Malterer, des im Konzentrationslager ermordeten ersten Mannes seiner Frau. Angesichts dieses Bildes formieren sich die Langsbacher zur Brigade Malterer. Und der vermittelnde, alles überschauende Eisenkolb? Er hat schließlich wenig Eigenes, wird blasser, je kräftiger die anderen werden. Die anfangs eingeführte Rolle einzelner wandelt sich.
Was leistet Ramms ungeduldiges Wollen? Wenig, denn wirksam werden Pflocks Konzeption und Eisenkolbs geschicktes Instruieren. Utopisches Wollen scheint sehr leicht widerlegt, denunziert durch das Handeln derjenigen, die zwar nicht sofort den Kommunismus errichten können, aber historischen Fortschritt in Richtung auf ihn durchsetzen. Aber so einfach ist bereits in diesem Buch Köhlers die Frage nach Wert oder Unwert von Utopie nicht beantwortet. Ramms utopisches Wollen leistet viel: Es bestimmt das Maß seiner kritischen Sicht auf das Erreichte, das ihm gleichzeitig Maß malerischer Gestaltung ist. Ramm malt die Langsbacher und die Kurzbacher Druschplätze in ÖI und hängt das Gemälde ans Schwarze Brett in Kurzbach. Was sehen die Bauern? Den Druschplatz im genossenschaftlichen Kurzbach: "Die ganze Anlage war so gestaltet, daß jeden, dem die Spielfreudigkeit des Kindes noch nicht ganz abhanden gekommen war, Lust anwandelte mitzuspielen. Es war offenkundig: hier machte das Dreschen, eine der schwersten ländlichen Arbeiten, Spaß ... Anders Langsbach! Hier sprang dem Betrachter ein wüstes Durcheinander von Spreu, Siebkaff, Stroh und Getreidemieten der verschiedensten Formen und Größen ins Auge." Das Ergebnis: "Bald verbreitete es sich im ganzen Dorf: Die Langsbacher sind blamiert'." Dies ist der letzte Anstoß für reales Geschehen - in Langsbach wird die LPG gegründet.
Ramm malt, was er sieht, aber er sieht keine Menschen. "Oder soll ich vielleicht die Freiarbeiter malen, deren Anblick mir schon ein Würgen in der Kehle verursacht? Oder diese kriminellen Prämienjäger, die kaltschnäuzig alles verderben lassen, wenn keine bare Münze dabei herausspringt? Oder die Bauern, die sich jetzt schon wieder überlegen, ob sie in der Genossenschaft den Staat nicht noch besser betrügen können als zuvor? Ich sehe überall nur Eigentümer, Besitzer, Drückeberger, Narren, Spitzbuben - Schatzsucher! Und ihre Gesichter! Verlogen, hämisch, höhnisch, tückisch, brutal, stumpf, überheblich, aalglatt, arrogant, verbohrt, feindselig - Visagen. - Wie soll ich da Menschen malen?" Schließlich malt er den Kommunisten Malterer, versucht, sich von allen Menschen seiner Umgebung zurückziehend, mit diesem Bild - alle seine Ideale vom wahren Menschen mitzuteilen. Das fertige Bild behält seinen Betrachter im Auge, ist geeignet, ihm Gewissen zu sein, mahnt ihn, das Ziel nicht zu vergessen. Das Bild ist die Ursache für Ramms Tod: Der Agent des Klassenfeindes tötet ihn. Entschlossen, den gefährlichsten Mann umzubringen, den, der der Wiederherstellung der alten Zustände am meisten entgegengewirkt hat, hatte er sich soeben noch für Eisenkolb entschieden. Nun, nachdem er die Enthüllung von Malterers Porträt und die Verpflichtung der Bauern vor ihm erlebt hat, tötet er Ramm. Zumindest im Kopf des Klassenfeindes hat sich die Bedeutung der Personen umgekehrt.
So stellt sich her: eine enge Verbindung von utopischem Entwurf und Kunst. Die Kunst gewinnt ihre Kraft aus dem Festhalten am Ideal. Was bezogen auf die gesellschaftlichen Zustände Utopie war und versagte, gerinnt in der Kunst zum unverzichtbaren Maßstab und Spiegel. Dies ist in "Schatzsucher" als Motiv kräftig angegangen - zu kräftig und eindeutig wohl. Auflösung des Gegensatzes von Utopie und Wirklichkeit durch Überschätzung der Kunst, restloses Verdrängen der Utopie aus den handlungsbestimmenden Motiven ins Reich der Kunst. Dies ist anders in Köhlers vorerst letztem Roman "Hinter den Bergen". Dazwischen liegt "Der Krott oder das Ding unterm Hut". Nicht nur zeitlich.
"Der Krott" enthält im Titel keine Genrebezeichnung, ist aber wohl eher eine Erzählung als ein "kleiner Roman". Im Unterschied zu "Schatzsucher" und "Hinter den Bergen" mit jeweils vielfältigem Figurenensemble, chronikartiger Erzählhaltung bestimmt hier eine Figur - Paul Jordan - die Erzählung: Er ist es, der träumt, der wahrnimmt, der erlebt.
Paul Jordan ist Kulturverantwortlicher in der BGL eines Kraftwerks. Die Erzählung beginnt mit einer geträumten Vision: der Vision einer paradiesischen Landschaft, in der Natur, Mensch und Tier in ungetrübter Harmonie miteinander leben. Den wilden Tieren wurde mittels Auslese ein Verhaltensprogramm antrainiert, in dem der Mensch als Beuteobjekt fehlt. Und die Menschen werden mit immunisierendem Balsam gesalbt und von früh an in Tierpsychologie geschult. "Alle Verwaltung ist darauf abgesehen, die Natur zu wahren und zu mehren". "Dies ist das Land, wo Milch und Honig fließt." - Eine Utopie im verbreitetsten, schlichtesten Sinne - Schlaraffenland, Illusion, unrealistischer Traum. Nun haben Utopiebildungen in der Geschichte und erst recht in der Kunst immer etwas mit der Realität zu tun - als Gegenbild, als positive, sei es auch illusionäre, Aufhebung konkreter Mängel, empfundener Mißstände der Wirklichkeit. Warum träumt im "Krott" Paul Jordan ein natürliches Paradies? Wozu dieses Gegenbild "vollendeter Harmonie"? Warum der Wunsch: "Zeigt mir den Platz, das Plätzchen, für das nicht Voraussetzung, Bedingung, Widerspruch gilt. Ein, zwei Prämissen müssen schon erlaubt sein, will man eine Menschheit träumen, deren Artenegoismus sich nicht im materiellen Verbrauch der Natur erschöpft, sondern sich vielmehr zur Anschauung all ihrer Formen verfeinert hat." Verfeinerte Anschauung statt des materiellen Verbrauchs der Natur, so die erträumte Alternative, für die - so ist zu vermuten - die Ursache in Paul Jordans täglich erlebter Umwelt liegt.
Bereits wenige Seiten weiter wird der Traum konfrontiert mit den "Erfordernissen des Tages": "... Energie, spezifische Wärmeverbrauchswerte, technische Wirkungsgrade, Materialverbrauchsnormen, Leistungskurven. Alles, was damit nicht unmittelbar zu tun hat, erscheint als schwächlich, abwegig, fast verdächtig." Gemessen an den Erfordernissen des Tages erscheint Jordan nicht nur sein Traum schwächlich, fast verdächtig, sondern auch seine eigene Tätigkeit. Ist das Ziel der Kulturarbeit, der sozialistischen Kulturrevolution - Bedingungen für die Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten zu schaffen - ein utopischer Traum? Die Gleichsetzung des Nachttraums und der Rolle von Jordans täglicher Arbeit legt diese Frage indirekt nahe - noch bevor Jordan von dem ominösen Krott befallen wird, der ihn geistig verwirrt und das heißt zunächst: ihn Ungewohntes und (leider) für den Kulturfunktionär Ungewöhnliches tun läßt. Jordan legt provokativ eine Schaufensterpuppe in eine der gläsernen Vitrinen auf dem gläsernen Platz. Denn: "... ein siebenfaches Nichts in Scheibenschreinen" scheint ihm Nichtachtung derer, die an sieben Wochentagen im Kraftwerk mit der Natur ringen. Jordan geht "vor Ort", d. h. in die Werkhallen. Er weckt mitten in der Nacht seine Tochter. Er hört imaginäre Gespräche über Kunst. Überall sucht er den Sinn seiner Arbeit, der Kulturarbeit. Was erfährt er? Zunächst erlebt er die Bedingungen, auf die Kulturarbeit trifft. Schwere Arbeitsbedingungen, unter denen die Kollegen Werktätigen arbeiten müssen. Schwere Schinderei, Verletzung der Arbeitsschutzbestimmungen auch. Statt mit den Arbeitern ins Gespräch über Kultur zu kommen, findet sich Jordan plötzlich in ungewohnter Lage: "Ich liege mit dem Rücken auf dem Trommelboden und stemme mit beiden Füßen, das erlaubt die rationellste Kraftentfaltung, dieses sogenannte Leitblech, vier Meter lang, etwa dreißig Zentimeter breit, mindestens anderthalb Zentner schwer, gegen die Halterung. Die Angst um meine Knochen verleiht mir ungeahnte Kräfte. Kollege ZRB versucht die Schiene mittels Bolzen zu befestigen. . . . Das dauert und dauert. . . . Mein feuerfester Arbeitsschutzanzug klebt wie ein nasser Sack am Leibe. Schaum tritt vor die Lippen, vermischt mit salpetrigem Kohlenstaub. Und ZRB fummelt. Nein, er tückscht dabei nicht mir zum Fleiß ... So ist das nicht. Nur ist es eben fraglich, ob das der rechte Weg ist, mit Werktätigen ins Gespräch zu kommen." Nein, es ist der rechte Weg nicht und auch nicht die rechte Lage. Und doch beneidet Jordan die, die hier schuften. Der Nutzen ihrer Arbeit ist klar. Sie tragen ihn als Ausweis auf den Helm gedruckt - in Form von Buchstabengruppen ZRB, BMSR. Was aber könnte sich Jordan auf den Helm schreiben? Mitautor des BKV? Doch gerade dieser, der Betriebskollektivvertrag, löste sein ruheloses Suchen nach dem Sinn eigener Tätigkeit aus - und natürlich der Krott. Seine Frau, Deutschlehrerin, hat dieses Werk kritisiert. Genauer: es als Beispiel für schlechtes Deutsch, für unschöne Häufung der Infinitive nämlich, zu Unterrichtszwecken mißbraucht. Ihre - verstiegene - Forderung: "Ein Werk wie dieser Betriebskollektivvertrag, geboren letzten Endes aus dem Kommunistischen Manifest und dessen konsequente Fortsetzung, muß auch so gut und schön wie jenes verfaßt sein. Es muß ein erbaulich Lesen darin sein, und nicht nur seines Inhalts wegen. Große und richtige Gedanken müssen schlicht und schön gesagt werden. Mut und Freude müssen sie verbreiten: Seht, das haben wir uns vorgenommen!" - Wie sollen Formulierungen aussehen, die geeignet sind auszudrücken, was hier geleistet wird? Ganz sicher jedenfalls nicht so, wie es Jordans Frau schaudernd liest: "Die Ziele ... sind ... auszuarbeiten und haben ... zu orientieren, um ... zu erreichen, wobei ... zu berücksichtigen sind." Und auch nicht so, wie Köhler es als karikierendes stilistisches Mittel einsetzt. Häufung unverständlicher Abkürzungen, substantivierte Verben, zu Formeln geronnene Begriffe. Dünne Abstraktion, in der nicht mehr sichtbar wird, was geschieht. Im imaginären Gespräch über Kunst hört Jordan den Schriftsteller auf das Mittel gegen diese Verflüchtigung von Realität ins leere Symbol verweisen: "Beschreiben, beschreiben, beschreiben." Ein anderer Zusammenhang diesmal, in dem Kunst erscheint: Kunst als "gesteigertes Sehen, Empfinden, Mitempfinden" ist nun nicht Aufbewahrungsort von Utopie, sondern Chronik des heutigen Werks für die künftig Lebenden. Und warum plaziert dann Jordan in die ehemals leeren Glaskästen utopische Literatur? Wo ist die Brücke vom heutigen Tun zur Zukunft?
Zukunft ist Jordan wichtig. Wie wird sie aussehen? Sein Töchterchen hat da ganz "klare" Vorstellungen: "Jeder wird tun, was ihm gefällt, nach seinen Fähigkeiten und Bedürfnissen ... Niemand wird sich einschränken müssen. Ungebildete wird es nicht geben." Jeder wird nach "IK - KI" leben können (Immanuel Kant - Kategorischer Imperativ), Regelungen, Programmierungen werden nicht nötig sein. Die Voraussetzungen? Das werden die Erwachsenen mit ihren Maßnahmen und Methoden - Regelungen und ähnlichem - schon schaffen. Doch gerade daran hat der Papa im Moment seine Zweifel. Und dies verstört das Fräulein Tochter: ..,Warum machst du denn Programme mit? Warum arbeitest du denn in einer Leitung mit am entwickelten System des Sozialismus, wenn du nicht daran glaubst? Warum hast du mich und meine Schwester? Warum hast du denn Kinder? Ach, Papa, Papa, warum läßt du mich nicht ruhig schlafen? Es ist späte Nacht. Oder', in ihren Augen glitzern Tränen, 'oder - bist du vielleicht krank?'"
Ja, ist Jordan, der nie zweifelte und schwankte, vielleicht krank? Nun, er ist vom Krott befallen, seine Zweifel könnten Ausdruck beginnender Wahnvorstellungen sein. Durch den Einfall "Krott" nimmt Köhler den gestellten Fragen den "tierischen Ernst", hebt sie ins luftigere Reich poetischen Spiels - aber er hebt sie nicht auf. Vielleicht ist wirklich unzulänglich, was Jordan und andere tun, wenn sie den BKV - und nicht nur diesen - zu einem "Programm zur Steuerung und Regelung zwischenmenschlicher Beziehungen" gemacht haben? Vielleicht ist auch der Traum, den Jordan anfangs träumte, falsch? Weil Steuerung und Regelung, Systemregulierung und was der Begriffe mehr sind, inadäquate Zielstellungen sind, wenn es um menschliches Verhalten geht. Auch in jenem Traum war alles programmiert - mit Salben einerseits und Auslesemethoden andererseits. - "Der Krott" ist ganz offensichtlich in einer Phase unserer Entwicklung geschrieben, da übereifrige Wissenschaftsgläubigkeit im Fortschritt vor allem eine Sache immer besserer Programmierung und Steuerung sehen ließ. Die kritisch angegangenen Begriffe weisen es aus. Weder lassen sich aber Köhlers Intention noch der Gehalt insgesamt auf diese Ebene beschränken. Jordan wird den BKV umschreiben lassen, durch den aus dem Kulturfonds bezahlten Schriftsteller. Ist dies nun das letzte Wort im "Krott" zu den Fragen, die Jordan beunruhigt haben: "Schöne", utopische Literatur im Glaskasten und die schönere Formulierung des Betriebskollektivvertrages? Nach der Überschätzung von Funktion und Wirkung der Kunst in "Schatzsucher" nun ihre Verniedlichung zur "schönen" Verkleidung? Im erzählten Geschehen hat die Kunst nunmehr wenig zu tun mit dem, was in Paul Jordans verkrottetem Kopfe vor sich geht. Er träumt wieder einmal - diesmal nicht im Bett, sondern in der unbequemen Trommel. Diesmal nicht ein natürliches Paradies, sondern einen gesellschaftlichen Zustand, in dem das Geld als Zahlungsmittel nicht mehr nötig ist. Heute noch ist das Geld Kondensator menschlicher Energieumwandlung. "Der Rest unserer Gegenwart. Die Zukunft beginnt mit der Lösung des Problems kondensationsloser Energieumwandlung. Wir müssen uns beeilen" - Das Motiv der Schatzsuche wieder als der Zukunft entgegenstehend. Das Gegenbild: ein Zustand, in dem es die Menschen nicht mehr nötig haben, ihre Leistung über das Geld zu erfahren und zu repräsentieren. Sie werden ihre Leistung und ihren Verbrauch abschätzen gelernt haben, die Anschauung wird ihnen mehr gelten als das Verbrauchen. - Mitten im schönen Traum rasselt diesmal nicht der Wecker, aber der Krott in Jordans Kopf und läßt ihn - wie passend zum Traum - «tausendstimmiges, zartbrausendes Eiapopeia" von Kinderstimmen hören. Ein kräftiger Hammerschlag befreit Jordan vom Krott. Das Träumen allerdings ist ihm nicht vergangen. Im Krankenhaus träumt er noch einmal: eine "graphische Darstellung des Prinzips der Energieerwirtschaftung der Mittel für die erweiterte Reproduktion». Noch einmal wird die Vorstellung vom selbstregulierenden System ironisiert, in dem nichts mißlingen kann, in dem nur eine unklare und damit potentiell störende Größe ist: "Auf welch geheimnisvolle Weise kommt dabei die neue erweiterte, höhere, reinere, uns allen teuere Arbeitskraft zustande, die das System braucht und bedingt? Mir will das magere Pfeilchen nicht genügen. Ich setze einen Trichter oben auf das vage Gefäß und beginne mit mächtiger Kelle zu schöpfen. Aus Mangel an Einsicht fülle ich Masse in den Trichter, hoffend, es fände sich darunter, wie Erz im Gestein, jenes unerfindliche Keimchen Sinnerfüllung, welches ich Pathos nennen möchte, Hochgefühl des bewußten Seins, ständig gegenwärtige, handlungsumschlossene Anschauung der Natur und aller eigenen Schritte darin."
Im Traum hat Jordan diesmal den Sinn - vielleicht - gefunden. "Der Krott" nimmt auf seine Weise das thematische Leitmotiv der "Schatzsucher" auf: Wie wird unsere Zukunft aussehen, was von unseren Vorstellungen über sie ist Traum, ist Utopie, was ist notwendiger Maßstab, um den Sinn heutigen Tuns nicht zu verlieren? Wichtig ist Köhler dabei - dies durchzieht alle seine Werke - künftiges Verhalten zur Natur. Ohne Romantizismus besteht er doch auf dem Menschen als "Naturwesen", der, bei allem notwendigen pragmatisch-instrumentalen Verhalten zur Natur, doch des Anschauens der Natur bedarf - als Moment notwendiger Selbstanschauung.
Die versuchte Analyse macht es wohl deutlich: "Der Krott" ist in seinem Grundton von ironischer Polemik geprägt. Ironische Distanz ist da gegenüber allen technokratischen Vorstellungen, denen die Zukunft nichts anderes ist als die Gegenwart - nur noch ein bißchen besser -, oder in denen die Frage nach der Zukunft gar keinen Platz hat. Ironische Distanz aber auch gegenüber dem Eiapopeia vom paradiesischen Schlaraffenland. Der Entwurf bleibt konturlos, Kontur aber gewinnt die Bestimmung seiner Funktion: für die Art, wie wir denken, handeln und sprechen. Köhler polemisiert auch gegen eine bestimmte Art zu sprechen. Gegen Schemata, zu denen Sinn gerinnen kann. Er setzt sprachliche Klischees und Verwahrlosungen - die unerträglichen Infinitivkonstruktionen, Genitivanhäufungen, sinnlosen Kürzel - ein, um eilfertiges und oberflächliches Denken zu denunzieren, das sich auch in der Leere der Glaskästen vergegenständlicht ("Ausersehen, zu enthalten, sind sie selber Inhalt einer gründigen Idee. Ausersehen, zu enthalten, umfassen ihre Scheiben Leere.") Köhler geht die leere Formel an, die die Welt-Anschauung ersetzt. Dies alles wird erzählt, nicht deklamiert. Heiterkeit stellt sich her, oft gemischt mit betroffener Selbstbefragung, wenn zu lesen ist, wie inadäquat wir oft ausdrücken, was sich doch der flinken klischeehaften Benennung widersetzen sollte. Genauigkeit im Denken und Formulieren als Tugend, als Voraussetzung auch, uns über Gegenwärtiges wie Zukünftiges zu verständigen.
"Hinter den Bergen" wirft das Thema des Wohins ganz anders auf. Eine Utopie ist hier nicht nur Antrieb für das Handeln eines einzelnen und nicht nur Quelle eines in Kunst vergegenständlichten Ideals, hier wird eine Utopie verwirklicht. Utopia - seit Thomas Moras einen abgegrenzten Ort der idealen Gesellschaft bezeichnend - liegt hinter den Bergen. Im Dörfchen Ruhin. Was in Ruhin geschieht während drei Jahrzehnten -von 1945 bis 1975 -, wird hier auf eine umwerfend amüsante, philosophisch gegründete und von Einfällen übersprudelnde Weise erzählt. Verkürzt wiedergegeben: Auf Initiative des merkwürdigen Laienpredigers Rufeland begründen die Nachkriegs-Ruhiner, Eingesessene und Zugewanderte, eine Kommune. Sie eignen sich das Land an, bebauen es gemeinsam, wirtschaften gemeinsam, sie bauen einen Speicher und eine Kirche als Stätte, in der das Wort Gottes, und das heißt in Rufelands Munde, das Wort des Gemeinsinns und des tätigen Geistes gepredigt wird. Rufeland bedient sich "gemischter Methoden": kleiner Wunder und eines in der Scheune niederkommenden Weibes, das er zur Maria und dessen Kind er zum Jesuskindlein stilisiert. Die Kommune floriert, sie erfüllt. auch die staatlichen Erfassungsauflagen. Aber: Sie widerspricht dem, was vor den Bergen geschieht, dem normalen Verlauf der Bodenreform, der Herausbildung eines neuen Eigentümerbewußtseins bei den Bauern. Schließlich zerfällt die Kommune mit tatkräftiger Hilfe tatkräftiger Leute aus Vorbergen, mit Hilfe zum Beispiel des Erfassers, Genossen Waag. Die "Jungfrau Maria" gebärt ein Kind nach dem anderen, die Kirche bleibt unvollendet, das Land wird verteilt. Und dies in einer Zeit, da vor den Bergen bereits der Übergang zu Genossenschaften beginnt. In Ruhin wird normalisiert, und plötzlich stimmt nichts mehr. Die Abgabe- und Anbaupläne werden nicht erfüllt, soziale Unterschiede entstehen neu. "Hinter den Bergen, da ging eben nichts nach der Regel." Inkongruenz, Abweichung ist die Grundsituation Ruhins. Wo die Kongruenz mit Macht hergestellt wird, ist es zunächst zum Schaden - Ruhins wie der Gesellschaft vor den Bergen. Als schließlich nach langem Drängen auch in Ruhin eine Genossenschaft entsteht, ist sie es nur dem Namen nach - die Ruhiner wollen ihre Ruhe haben. An den inzwischen normalisierten Zuständen ändert sich nichts. Der Konsum steigt ständig, aber die Ruhiner haben keine Muße, ihn zu genießen. Sie sind unzufrieden. Aus der Kommune wird schließlich ein Kurort, die Kirche - dem Abriß mit knapper Not entgangen - wird zur touristischen Sehenswürdigkeit. Die Ruhiner sind alt geworden, die sechs Kinder der Alma Teutschke - der einstigen "Jungfrau" - bestimmen mehr und mehr das Gesicht des Dorfes. Aus Ruhin ist eigentlich Teutschkendorf geworden.
Soweit die Geschichte, die erzählt wird. Erzählt wird sie von einem, der sich als Chronist gibt, seinerseits einer vorliegenden Chronik nur folgend: den Notizen und den in die Kirchenfenster gemalten Bildern, die Ahnfeld hinterließ. "Hinter den Bergen" ist das wichtigste von Köhlers Werken. Nicht nur, weil es ein so besonderer Beitrag ist zur Selbstverständigung über uns, über unsere Träume, auf die wir nicht verzichten wollen und sollten und die im Handeln ihre Veränderung erfahren. Es ist sein wichtigstes Werk, weil das Besondere seiner Erzählkunst hier durch keinerlei vordergründige und eindeutige Unterbrechungen eingeschränkt wird. Köhler vertraut zu Recht der Überzeugungskraft der Poesie. Von symbolischer Namensgebung bis zum ironisierend-relativierenden Erzählerkommentar, von den beschriebenen Bildern bis zur bildhaften Sprache sind die Mittel immer wieder neu, mit denen poetische Prosa erzeugt wird. Souverän stellt der Erzähler Figuren in den Mittelpunkt und rückt sie ins Abseits, wenn ihre tatsächliche Rolle sich verändert hat, ja, schickt sie sogar ins Gefängnis oder läßt sie unklar verschwinden. Randfiguren noch werden mit derselben poetischen Gerechtigkeit behandelt wie Rufeland oder Alma. "Sprachröhren" des Autors, Figuren, in denen die ganze Wahrheit versammelt wäre, gibt es nicht mehr. - Müßig schiene mir, angesichts dieses Werkes die Frage nach literarischen Traditionen zu stellen, in denen Köhler steht. Wenig wäre damit gesagt über das Eigene dieses Erzählers, über den poetischen Gehalt, der uns so sehr angeht. Schon die verknappte Fabel deutet den poetischen Grundeinfall an: Aus dem kleinen "Himmelreich in Ruhin" wird das "Kulakennest", wird das Konsumreich Bolles, des Besorgers, wird "Milieu", "Schauwerk" für Urlauber, wird schließlich ein Kurort für Herz- und Kreislaufgeschädigte, ein "Asyl für die Ermüdeten aus einer bewegteren Welt".
Dies ist ein Roman, in dem das Thema der zu früh und zu spät Gekommenen auf eigenwillige Weise aufgenommen wird. Für das ganze Ruhin: Die Kommune war - sagen wir es vorerst so grob - eine Vorwegnahme, nach ihrem Zerfall hinken die Ruhiner der Entwicklung hinterher, "im normalen Mittelfeld" fühlen sie sich nicht wohl. Vor allem aber ist das Motiv der zu früh oder zu spät Gekommenen zunächst auf Rufeland bezogen, der in den ersten beiden der vier Bücher des Romans im Mittelpunkt des Geschehens steht, später zur Randfigur wird.
Wer ist Rufeland? Ein Hutmacher, der es im braunen Reich nicht vermochte, die passenden Kopfbedeckungen zu den braunen Uniformen zu machen, statt dessen zu predigen begann - "Es ist ein verhängnisvoller Hang zum Tragen schneidiger Skimützen über die Deutschen gekommen. Wehe! Wenn die Zeit da ist, wird es an ein Schlittenfahren gehen, den Hang hinab, und grausiger Nebel wallt in den Tälern." Er erzählt "vom Reiche Gottes, das anbrechen werde, wenn die Menschen einander wieder barhäuptig achteten". Die Predigten führten schließlich zu seiner Einlieferung ins Konzentrationslager Sachsenhausen. Er überstand den Todesmarsch und findet sich mit seiner Schwester Nele bei Kriegsende in Ruhin wieder. Er ist von unantastbarer Integrität, dieser Prediger. Was sind seine Motive, hier in Ruhin ein "Gottesreich" zu errichten? "... das wunderliche Zusammentreffen mehrerer im einzelnen nur platt erklärbarer Umstände mußte(n) in ihm das Bewußtsein einer bestimmten Auserwähltheit wecken. Wozu das, wenn nicht zu dem Behufe, Verhältnisse zu schaffen, ein kleines Reich, ein Beispiel der Verschmelzung des Menschen mit dem innewohnenden Gott... Wir wittern eine tragikomische Verfehltheit. Und doch, er stellte etwas dar in seiner Art und wahrte die Tradition der dünnen, aber nie abreißenden Kette zu früh oder zu spät Gekommener." Ist er ein zu früh oder ein zu spät Gekommener?
Diese Frage beantworten heißt den Ideengehalt des Buches bestimmen, heißt den Charakter der Rufelandschen Utopie klären. Einfachste Antwort, und auch sie wird vom Erzähler kommentierend vorgeschlagen: Was Rufeland will, das gelobte Zeitalter der Brüderlichkeit, der scheuen Menschengemeinschaft, das blühende Paradies für tätige Gleiche, die Lilienoase - Bild blühender Natur - ist eine chiliastisch getönte, damit letztlich konservative Utopie. Rufeland scheinen die Zeichen günstig: Ein abgeschiedener Ort, verzweifelte Menschen ohne Hoffnung, eine Herde schließlich, die bisher zu folgen bereit war und die zu folgen bereit sein wird. Es bedarf nur des "Hirten". Rufeland ergreift die Initiative. Was er dabei leistet, ist das Nötige. Ganz schlicht verhindert er zunächst, daß Alma und das Neugeborene in der Scheune zertreten werden, indem er die andrängende Menge auf die Knie zwingt und ihnen das "Zeichen", deutet - als Zeichen der Hoffnung, der Verheißung, Zeichen aber vor allem, das zu tun, was not tut. Und dies heißt: das Land aufteilen, durch gemeinsame Arbeit in Besitz nehmen. Und Hoffnung geben, ein Ziel, eine Idee - "fromm ist, was der brüderlichen Menschengemeinde frommt". Mit religiösen Dogmen hat, was Rufeland predigt, wenig zu tun. Er bedient sich recht listiger Methoden - "gemischter", wie Schwester Nele kritisch vermerkt. Mit Versprechungen und angedeuteten "Wundern" zwingt er die Ruhiner zum Leben, zum Gemeinsinn, zur Kollektivität. Viel muß ihm einfallen, denn "alles muß man ihnen sagen", was jenseits des nackten Egoismus ist. Und viele Schläge muß er hinnehmen: Alma, die Mutter des erwählten Knaben, ist allzu nachgiebig oder auch allzu sehnsüchtig nach etwas Liebe, zu gebärfreudig schließlich. Als Jungfrau Maria nicht tragbar, wird sie Köchin in der Gemeinschaftsküche. Der Damm um das Inselreich Utopia bröckelt. Der Genosse Waag, der Erfasser, durchbricht ihn, und Bolle, der Besorger schleppt die Verlockungen und Konsumfreuden des Handels ein. Rufeland braucht viel Kraft, er bezieht sie aus dem Glauben an seine Mission, sein Erwähltsein. Und er überträgt diesen Glauben, außerordentlich zu sein, auf andere. Auch ihnen wachsen damit ungeahnte Kräfte zu. Beispiel: die Landarbeiterin Grabowski wird zu einem der Funktionäre, die die Kommune wählt. Rufeland wollte den Vergleich schaffen, wollte die Konkurrenz mit der Gesellschaft, die seine Kameraden aus dem Lager vor den Bergen errichten, wollte den Wettbewerb verschiedener Modelle brüderlicher Menschengemeinschaft. Sein Modell unterliegt. Es bedarf nur noch der als lästerlich empfundenen Osterpredigt Hänschens, des Erwählten, als Anstoß, und das Gebäude stürzt zusammen. Die Ruhiner wollen nicht mehr auf die Annehmlichkeiten fleischlicher Genüsse, persönlichen Reichtums verzichten, sie entwickeln Eigentümerbewußtsein. Und da sie dies später tun als die Vorbergener, tun sie es gründlich: Das Land der Schwachen, Alleinstehenden, Arbeitsunfähigen wird von den Kräftigen angeeignet. Diese wollen nunmehr für sich arbeiten, nicht mehr für alle und für eine imaginäre Zukunft. Das geplante Kommunehaus - Rufelands Vision einer Burg der Brüderlichkeit - bleibt in den Fundamenten stecken, die Kirche bleibt ohne Dach. Die Kommune zerfällt. Hans Teutschke, das Jesulein, wird staatlich erzogen, meldet sich später zum Dienst in den bewaffneten Organen. Die Utopie ist verschwunden, hinweggeschwemmt vom Gang der Geschichte. Und doch: Etwas ist geblieben. Die Kirche steht und mit ihr die Bilder, die Ahnfeld auf ihre provisorischen Fenster gemalt hat. Und hier ist wieder der Zusammenhang Utopie und Kunst - gegenüber "Schatzsucher" ungleich verhaltener, geheimnisvoller, weil mehrdeutig. Ahnfeld hat gemalt, was in Ruhin geschah, und er hat seine Vision der Zukunft gemalt. Sein Motiv: Liebe zu Alma. "Meine ganze Liebe habe ich drangegeben, dieses Weibsbild zu erhöhen, das hier geächtet und geschunden und geschändet vor mir steht." Das erste Buch endet mit Ahnfelds Angebot, die Kirchenfenster zu bemalen, am Ende des zweiten Buches findet Rufeland, aus zweijähriger Haftstrafe heimgekehrt, die Kommune aufgelöst, aber neu dafür die Bilder auf den Fenstern der nunmehr unbenutzten Kirche. Im dritten und vierten Buch sind die Bilder Hintergrund des Erzählens, Gegenstand der Umdeutung und Ausdeutung durch den Erzähler und schließlich Objekt fotografierender Touristen, Teil der Ruhiner Sehenswürdigkeiten. Das Schicksal der Bilder widerspiegelt die Geschichte Ruhins. Im Mittelfenster die heilige Jungfrau mit Almas Gesicht, auf dem Arm nicht einen erwählten Knaben, sondern ein halbes Dutzend Kinder. Um diese Gruppe die Ruhiner bis hin zum Hunde Kuno.
Im nächsten Fenster der nackte Mann, Teil der Geschichte, einziger Büttel in der Vergangenheit Ruhins, Symbol ausgestoßener Gewalttätigkeit. Dann Alma unverklärt, mit den nährenden Attributen Schöpfkelle und Suppenkessel, Alma in der Gemeinschaftsküche. Die nächsten Fenster zeigen die gemalte Chronik Ruhins, Ereignisse, wie sie allen Einwohnern noch gegenwärtig sind, und das Bild Till Eulenspiegels in der Grube, zum Ausfahren bereit, mit dem Gesicht Hans Teutschkes. Auf der gegenüberliegenden Fensterfront Bilder; die Visionen der Zukunft geben: Symbole des Sehens und Gesehenwerdens, Symbole, die das Ende der Oase ankündigen, den Einbruch der Welt von draußen. Und die Vision eines Glaspalastes über den Gewölben der gedachten Kartause. Rufeland schaudert beim Betrachten der Bilder: "Das war kein Haus der Einkehr, keine Stätte stiller Sammlung; das war ein Tempel des Zwiespalts, des Widerstreits, der Unruhe und Erregung. Aber das Studium des gräßlichsten Anblicks stand ihm noch bevor. In dem großen auf die Spitze gestellten Fensterviereck über dem Eingang sitzt mit untergeschlagenen Beinen, in Purpur gehüllt eine Kreatur mit dem unverkennbaren Grinsen Oskar Bolles. Eifersüchtiger als das Weib im Hauptfenster ihren Kindersegen hütet der Götze über der Eingangspforte, ausgestattet mit sechs Armen, einen Wust von Waren. Es ist dies die einzige Darstellung, bei der sich der Maler hemmungslos einer überquellenden Fülle von Einzelheiten überläßt."
Dies ist der gemalte Gegensatz: das Bild der siebenköpfigen Madonna und der Konsumgötze. Oberflächlich lesend könnte man folgern: Aus der Kommune ist eine Konsumgesellschaft geworden, die Verteilung der Sympathien auf beide Zustände wäre dann eindeutig. Rufeland sieht es natürlich so: Die Fleischeslust, der materielle Konsum haben den Geist verjagt. Gestraft sind die Ruhiner durch den Verlust des Paradieses.
Für eine solche Lesart scheint noch etwas anderes zu sprechen. Die Ruhiner sind in der Tat nicht glücklich mit ihrem neuen Eigentümerbewußtsein, auch nicht mit ihrer halbherzig und lustlos begründeten Genossenschaft. Zu sehr wirkt in ihnen der einstige Beginn nach. "Wie alles Gewesene hob sich die frühe Zeit der Gemeinsamkeit mit dem größer werdenden Abstand immer deutlicher und bedeutsamer heraus. Wer so begonnen hatte, dem genügte der Appell von elektrischen Apparaten, Fahrzeugen, schönen Kleidern, selbst von barem Gelde nicht. Sehnsucht nach einem höheren Gegenstand der Betrachtung stellte sich ein. Das Phantom der Lilie geisterte ... " Versorgt mit allen erreichbaren Attributen des modernen Lebensstandards fehlt den "freien" Landwirten die Zeit, sie zu genießen. Zu mehr als einer halbherzigen Genossenschaft aber sind sie nicht mehr bereit. Auf Almas Drängen, zur gemeinschaftlichen Feldbebauung überzugehen, haben sie nur die resignierte Antwort "Was die will, ist viel zu schwierig, als daß es sein muß, denn schließlich hatten wirs schon mal." Sie sind unzufrieden, weil sie von anderem bereits gekostet hatten, aber es nicht zu Ende brachten. "Es ging um die Enttäuschung, um jenen abgebrochenen anderen Pfad, die andere, die unvollendete Variante. Es ging um den abgebrochenen Versuch, die versäumte, nein, verpfuschte Möglichkeit, die aus der Rückschau stets romantischer und weniger trist erscheint als der schließlich dann doch beschrittene Weg. Es ging um den verlorenen Garten Eden." Die Erinnerung lebt als Stachel in ihnen. Ist also der anfängliche Entwurf das Wahre?
Köhler träfe gewiß viele Emotionen, meinte er dies. Emotionen der Ungeduld, der Sehnsucht nach der schnellen Überwindung aller Rudimente egoistischen, privatistischen Verhaltens, nach dem Kommunismus schon heute oder morgen. Utopisch-sozialistische Vorstellungen gehören nicht nur zu den berühmten drei Quellen des Marxismus, sie sind - nicht als theoretisches Gebäude, wohl aber als Idealvorstellungen - heute durchaus vorhanden. Doch Köhlers Intention auf solche utopisch-sozialistischen Vorstellungen zu reduzieren, wäre zu einfach, der Wahrheitsgehalt des Buches wäre dann wohl auch in Frage zu stellen. Gewiß, die Utopie wird nicht einfach denunziert als Produkt eines halbverrückten Spinners, als bloße Notlösung unter den Bedingungen des Mangels. Rufeland hat - auch wider besseres theoretisches Wissen - die Sympathie des Lesers ebenso wie die des Chronisten. Der Leser zuckt unter den Schlägen betroffen zusammen, mit denen Rufelands Werk zerstört wird. Aber Trauer als Grundstimmung stellt sich nicht her. Dafür sind es zu viele Einfälle, mit denen die heroische Vergangenheit verabschiedet wird. Die "List der Vernunft" setzt sich auf wunderbare Weise durch die handelnden Personen und doch auch hinter ihrem Rücken durch. Die einzelnen werden von ganz unterschiedlichen Motiven bewegt. Was sie erreichen, ist mit dem, was sie wollten, nie ganz identisch. Zum Beispiel: der Bauer Wunderow. Er, der - in Eile und in Angst vor seiner Frau - Almas zweites Kind erzeugte, will dieses zum Hoferben machen. Mit allen Mitteln. Am Ende übernimmt nicht Sohn Konrad den Hof, sondern Wunderow wird LPG-Vorsitzender. Komische Verkehrung von Absicht und Ergebnis erfahren sehr viele der dargestellten Personen. Und doch haben Absicht und Erreichtes etwas miteinander zu tun, wenn auch auf skurrile, kaum identifizierbare Weise. Was schließlich aus Ruhin geworden ist, das ist ein abgewandeltes Bild der Visionen Rufelands und Ahnfelds: die gelbe Aue, ein Garten, eine liebliche Erholungslandschaft. Auch die schwarze Lilie könnte durchaus noch gezüchtet werden - Rufelands Symbol einer vom Menschen geprägten und ihm gemäßen Natur. Dazwischen allerdings Konrads Herde von Zuchtschweinen. Das Ganze keine Inselgemeinde Utopia, sondern ein Kurort. Unwiederbringlich dahin: das Kommunehaus als Form kollektiven Daseins. Zweckentfremdet ist das "Gotteshaus" nun Sehenswürdigkeit. Ahnfelds Bilder: bei der Restauration modernisiert in Zement und Glasklumpen. "... die Bildinhalte wurden konsequent einer neuen dekorativen Auffassung unterworfen ... Das Neue wurde schön glasbunt mit vielen lichtstreuenden Bruchkantenreflexen." Nur ein Bild konnte Rufeland vor der Modernisierung retten - ausgerechnet den Eulenspiegel. Eulenspiegel statt Jesus ist als Zeichen geblieben. Der plebejische Schalksnarr als Bild dessen, was in Ruhin vor sich ging, als Schlüsselsymbol wohl auch, um das Motiv des verrückten, aber nicht sinnlosen, des inadäquaten und doch treffenden Tuns zu umreißen. Für Tragik bleibt da wenig Raum.
Was die alten Ruhiner um sich herum sehen, wenn sie auf der Terrasse des Sanatoriums sitzen, zeigt manches von dem, was der Prediger ihnen vorgeschwärmt und verheißen hatte. ". . . nur daß sie es nicht allein getan hatten und schon gar nicht aus freien Stücken und daß es ihnen also auch nicht allein zugute kam, sondern vor allem solchen vom Getümmel des Großstadtlebens zumeist in Sorge um andere angeschlagenen Menschen".
Illusion war die Inselgemeinde. Ohne Sinn allerdings war sie nicht. Denn auch die in Vorbergen haben nach dem Sinn fragen müssen. Den Erfasser Heinz Waag, als Vertreter der Staatsmacht von Anfang an das Bindeglied der Welten vor und hinter den Bergen, hat die Frage immer gequält: Was ist Es? Es, das ist der Sinn. Er sucht ihn - und damit eigentlich ist Rufelands Absicht erfüllt - im Vergleich mit dem Ruhiner Geschehen. Ruhin - die Ruhe ist hin, Ruhin als Ruine des Gartens Eden, Ruhin als Motiv, nicht in Ruhe, d. h. Selbstzufriedenheit zu versinken. "Der moderne Bau ruhte ganz auf den von ihnen vorgelegten Fundamenten." Gemeint ist viel mehr als das neue spiegelnde Terrassencafé an der Stelle des geplanten Kommunehauses.
Köhler erzählt die Geschichte unseres Anfangs anders, als es in anderen Büchern zu lesen ist. Verfremdet durch den Einfall einer urkommunistischen Insel Utopia. "Einmal im Leben muß man an etwas Unmögliches geglaubt haben", dieser Satz aus Christa Wolfs "Nachdenken über Christa T." könnte Motto dieses Buches sein. Der Glaube versetzt zwar nicht Berge, kann Geschichte nicht willkürlich machen, aber er ist bewahrtes Ideal, Grundlage für das, was machbar ist.
Utopia ist aufbewahrt - in Bildern, im Gedächtnis, im Ziel. Utopia ist negiert, zerstört - die auf asketischen Gemeinsinn orientierte Gemeinde auf der Lichtung hat ihr Inseldasein nicht bewahren können. Verlust und Gewinn in einem. Verloren ist die Jugend, sind die ursprünglichen Bilder, verloren sind auch ungewöhnliche Initiativen und Hoffnungen. Entstanden ist ein neuer selbstverständlicher Lebensanspruch, sind neue Hoffnungen.
Ist die Utopie auch aufgehoben im dritten (Hegelschen) Sinne - auf eine höhere Stufe gehoben? Das letzte Buch des Romans hat gegenüber den vorangegangenen einen bescheideneren Ton. Die Ironie ist verhaltener geworden. Aus dem kräftigen Entwurf des Anfangs wurde die fast beschauliche Idylle, eingeordnet in ein Ganzes, dessen Bewohner sich in Ruhin entweder als Erholungsuchende oder als Väter von Almas Kindern versammeln. Die Ruhiner aber sind nun Lieferanten wohlschmeckender Schinken geworden. - Auch diese Idylle, die geordnete Provinz kann das allein Wahre wohl nicht sein. Köhlers Methode, geschichtliche Fragen in komischen Konstellationen aufzuwerfen, hält sich bis zum Schluß.
Stellen wir uns noch einmal die anfangs bereits angedeutete Frage - auch im Buch wird sie gestellt: Ja, darf denn so etwas sein? Ist utopisches Denken legitim? Geht es an, eine Zukunft ins Blickfeld zu rücken, deren Züge im einzelnen noch gar nicht klar sind und auf der andererseits bestanden wird? Auf einem jedenfalls besteht Köhler nachdrücklich: Zukunft heißt Kommunismus. Die Frage nach der Legitimität von Entwürfen dieser zukünftigen Gesellschaft, die auch utopische Momente enthalten, wäre zu simpel beantwortet, würden wir in solchen Entwürfen den unverbindlichen Spielplatz folgenloser Phantasie, schöner Wunschbilder in der Kunst sehen. Sicher gibt es eine besonders enge Verbindung zwischen Kunst und Utopischem, solange es Kunst gibt. Aber ebenso sicher wird in dieser Verbindung etwas zur Sprache gebracht, was auf allgemeinere Weise mit dem Verhältnis von Wirklichkeit und Möglichkeit, Wirklichkeit und Ideal zu tun hat. Die Frage etwa nach der Zukunft von Warenproduktion, Geld und Leistungsprinzip bewegt ja nicht nur Erich Köhler. Und die erkenntniskritische Abwehr von Utopie, wenn sie zum Ersatz wissenschaftlicher Analyse wird, sollte nicht unreflektiert zur Abwehr phantasievollen Erkundens künftiger möglicher Perspektiven und Alternativen führen, nennen wir dieses Erkunden nun Utopie oder nicht. Selten, auch nicht in Produkten theoretischen Nachdenkens über Sinn und Un-Sinn von Utopiebildungen, fand ich dieses Verhältnis so dialektisch gesehen wie in Köhlers Buch.