Mondfischfahndung
Bericht über eine Reise
DAS ERSTE KAPITEL UMFASST
SONNE, MOND UND STERNE


Wer stöhnt hier so traurig in der nächtlichen Ebene? Bist du es, du silberner Wandelgeist und Liebespärchenbeschatter?
Der Mond wird einen Schein bleicher und spielt den Erhabenen. Auf den Wiesen schwimmt sein zauberhaftes Licht. Welkes Kartoffelkraut würzt den Abendwind. Ich bin allein. Nur der Mond folgt mir seit einiger Zeit lautlos über den Wipfeln. Ich bin meiner Sache sicher, denn weit und breit ist keine Menschenseele zu entdecken.
Wieder seufzt er.
Da eine Bank am Wege steht, laß ich mich nieder und lade ihn gleichfalls zum Sitzen ein.
Er schaut sich erst umständlich nach allen Seiten um, ob wir auch wirklich ungestört wären, dann läßt er sich herab und bringt die Bank zum Knarren. Ich muß bis auf das äußerste Bankende hinausrücken. Dennoch darf ich beschwören: Seine rundliche Vollmondfülle täuscht. So ganz aus der Nähe wirkt er eher mager. Tiefe Runzeln furchen Stirn und Wangen. Er muß eine Ruhepause wohl nötig haben.
"Ein schöner Abend heute", taste ich mich vor.
Er kann es nicht bestreiten, schränkt jedoch sogleich ein: "Ist aber auch nicht mehr so wie früher."
Seit wann ist der Mond unzufrieden? denke ich laut. "Bin ich nicht", widerspricht er,"konstatiere nur den ewigen Wandel der Zeit. Denn ich war früher der Glücklichsten einer. Heute gehe ich mit Sorgen über die Zukunft um."
Ich überlege, wie ich den Mond noch weiter zum Reden bewegen könnte. Doch da beginnt er schon von selbst. Er ist eben doch ein Naturkind und keiner jener Selbstmachertypen und beidbeinigen Lebenssteher, die mit den besten Künsten nicht aus ihrer Reserve zu locken sind. Und so erzählt mir der Mond seine Geschichte:
"Der Schöpfer selig hatte dazumal wohl die geflügelten Worte gesprochen: 'Es werde Licht'. Und es wurde auch Licht, nur war nicht geklärt, wer der Erde leuchten sollte, die Sonne oder ich. Eh wir das merkten, legte er am siebenten Tage seine Schöpfungspause ein, die bis heute noch währt - denn was sind bei unseren himmlischen Maßstäben schon Pausen von einigen Jahrmillionen? Wir aber, die. Sonne und ich, stritten uns, ein jeder wollte den Titel des Taggestirns für sich haben. Wir konnten uns lange nicht einigen, bis die Sonne vorschlug, darum zu knobeln. Spitzfindig, wie sie ist, brach sie sich zwei Strahlen von ungleicher Länge aus der Krone, verdeckte die ungleichen Enden und ließ mich einen davon wählen. Ich zog natürlich den kürzeren und mußte mich für alle Zeiten damit begnügen, der Erde als Nachtwandler zu folgen.
Ich war darüber tief betrübt. Empfindlich für Stimmungen, wie ich nun einmal bin, zog ich mich zurück und weinte bitterlich. Die Sonne aber triumphierte. Viele meiner Tränen wurden vom Sonnenwind hinweggefegt und zerstäubt. Sie sind noch heute als Nebelflecken am Himmel sichtbar.
Viele andere flohen in den Weltraum, wo sie nun als die kleinsten unter den Sternen weiterschweben.
Nur eine einzige, meiner Tränen gelangte auf die Erde hinab. Dort fiel sie irgendwo ins Meer und wurde zu einem Fisch, dem silbrigen Mondfisch, der mir ähnlich ist."
Natürlich wundert's mich nicht im geringsten, daß der Mond so freimütig von seinen Tränen spricht. Denn erstens ist er eben das Gestirn der Emotionen, und zweitens steht es mir als Kind des zwanzigsten Jahrhunderts nicht an, mich irgend zu wundern. Nur eine Art Neugierde, wie die Geschichte wohl ausgehen mag, hat mich gepackt, denn er gilt ja mit Recht als in guter Märchenerzähler:
Der Mond wischt sich mit einem Nebelfetzen, den er von der Parkwiese nimmt, die Stirn, welche von der Feuchtigkeit hienieden beschlagen ist, bedenkt eine Eule, die vor sich hin kichert, was er auf sich bezieht, mit einem sphärisch gekrümmten Schimpfwort, bringt die Bank ein wenig zum Ächzen und fährt endlich in seiner Erzählung fort:
"Damals glaubte ich, nimmer froh zu werden. Was für ein Los hatte ich gezogen! Immer allein, immer bei Nacht, na, Sie wissen ja selbst, wie das ist. Und ich wäre verzweifelt, wenn nicht zu meinem Glück jene Sache mit Ikaros passiert wäre. Natürlich wandten sich die Menschen zuerst der Sonne zu, als der segensreichen Spenderin des Lichts und des Lebens. Aber in ihrem Übermut versengte die Undankbare dem ersten Menschen, der es wagte, sich ihr zu nähern, die künstlichen Flügel. So kam es, daß sich die Menschen mir zuwandten. Die Sonne bellt heutzutage nicht einmal mehr ein Hund an. Und es gab Zeiten, da gab es keinen Menschen, der nicht wenigstens in seiner Jugend schwärmerische Verse an den Mond schrieb. Ich war, nach der Liebe natürlich, das beliebteste Motiv menschlicher Sehnsucht, dem nicht nur Maler und Poeten, sondern auch ernsthafte Forscher ihre Aufmerksamkeit widmeten. Das war in Wahrheit meine glanzvollste Zeit.
Mit den Fortschritten der Wissenschaft verblaßte jedoch mein Bild bei den schöngeistigen Menschen. Wer schreibt heute noch Verse an mich! Und wenn sich ein Dichter dazu herabläßt, was kommt schon dabei heraus? Neulich verglich mich einer mit 'nem Schweizer Käse! Seltsame Surrogate meines Lichts sind ihnen wichtiger. Der Schein von Neonlampen steht höher im Kurs als der Schimmer des Mondes. Heute bin ich nur noch technisches Kalkül im Weltraumwettlauf. Wenn es hoch kommt, benutzt man mich eines Tages als Wochenendausflugsziel, verzehrt seine mitgebrachten Stullen bei mir und läßt das Papier zurück. Noch wahrscheinlicher ist, daß mich die Nachkommen derer, die mich einst angeschwärmt, zum Mülleimer für Atomkehricht machen. Ach, aller Glanz hat einmal ein Ende. Zwar ist es immer noch besser, ein trister Gebrauchsgegenstand von einigem Wert zu sein, statt gemieden zu werden wie die Sonne. Doch der Mensch verliert im gleichen Maße, wie er Besitz ergreift. Nie wieder werde ich sein, was ich ihm früher war, da ich noch unerreichbar schien.
Und doch kommt dieses Geschöpf, um das selbst wir Himmelskörper einander beneiden, nicht aus ohne die Sehnsucht nach dem Unerreichten. In diesem Drange wird sich der Mensch, indem er mich stofflich erobert hat, bald statt meiner noch mit der Jagd nach meinen Tränen begnügen müssen. Das heißt: die Sehnsucht bleibt, doch mit steigendem Aufwand sinkt der wahre Gehalt des Zieles, bis endlich, wenn er alles erobert hat, der Mensch, er nur noch gegenstandslosen Phantomen wird nachjagen müssen."
Ich überlege gerade, oh ausgerechnet ich, Schwärmer und Lokalpoet, kompetent genug sei, den alten Herrn darüber aufzuklären, daß wir als Menschen über Herkunft und Volumen der Sterne anderer Auffassung sind als er. Da mir jedoch seine Worte über die unstillbare Sehnsucht der Menschen und deren Aussichten mehr zu denken ge-ben als die ohnehin feststehenden astrophysischen Gegebenheiten, schweige ich lieber.
Ein Mopedfahrer kommt des Wegs dahergerast. Sein Blendscheinwerfer erhellt die Nacht zum Tage. Als ich wieder sehen kann, ist der Mond verschwunden. Nur ein bereifter Fleck auf der Bank zeigt an, wo er gesessen hat.
Nachdenklich gehe ich nach Hause. Da ich nicht einschlafen kann, nehme ich das Lexikon zur Hand und schlage nach unter M.
DAS ZWEITE KAPITEL UMFASST
ODYSSEUS UND DIE SCHILDBÜRGER
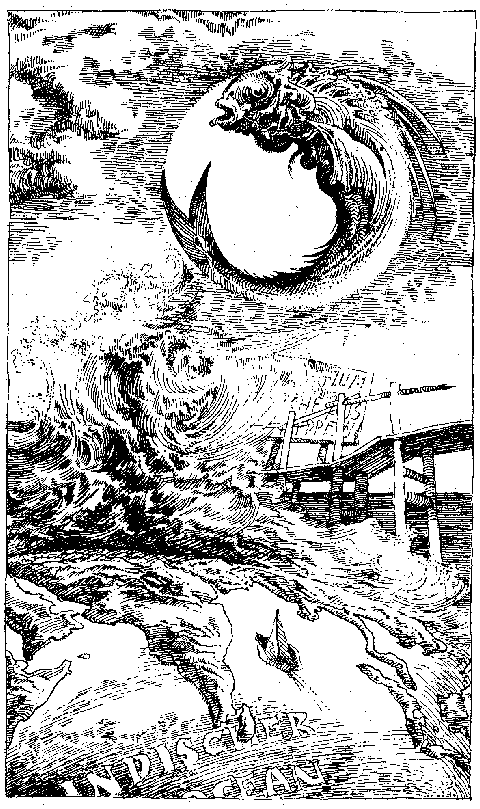
M - Mondfisch: Großer, seitlich zusammengedrückter Fisch der wärmeren Meere. Mit hohen sichelförmigen Bauch- und Rückenflossen, kurzer Schwanzflosse und gedrungenem Rumpf, mehr hoch als lang, gleicht er dem Viertelmond: Er wird bis zu zweihundert Kilogramm schwer, lebt friedlich von Algen und Kleingetier und ist auch im Mittelmeer zu Hause, wo ihn, wer Glück hat, mitunter schlafend und sich in der Sonne wärmend, an der Oberfläche treibend antreffen kann.
So heißt es im Lexikon. Und ich sehe ihn vor mir, wie er, eine goldene Sichel, durch die klare salzige Flut dahintreibt, einsamer als sein Stammvater oben und so sonnenhungrig; daß er seine Abstammung kaum leugnen kann. Träne des Mondes.
Hier fallen mir selbstverständlich die Schildbürger ein, welche, hör ich, seinerzeit vergeblich sich abmühten, die Mondscheibe mit Forken und mit Stangen aus dem Dorfteich zu langen.
Sie hätten also ans Mittelmeer gehen sollen, den Dorfteich der Alten Welt, diesen völkerumrandeten Schmelztiegel der Menschheit, dieser salzigen Sudpfanne zwischen drei Kontinenten, vielleicht hätten sie dort ein paar hundert Pfund zu Mondfisch geschmolzenen Silbers aus den Zutaten der Abflüsse Afrikas, Asiens und Europas herausgehoben.
Seit meiner Zwiesprache mit dem Mond, und besonders nach dessen prophetischen Worten, hat mich eine gewisse Torschlußpanik erfaßt. Ich bin ein Mensch wie alle anderen, mit Anspruch auf Sehnsucht und deren Erfüllung. Ist es nun unser Schicksal, hierbei den Tränen des Mondes nachzujagen, womit man ja schon begonnen hat, so fürchte ich, dabei zu kurz zu kommen. Denn selbstverständlich haben hierin Kosmonauten sowie die Abenteurer des Geistes an Projektierungstischen und Rechenautomaten einen beträchtlichen Vorsprung, soweit es die Sterne betrifft. Sie wissen zum Glück noch nicht, daß auch die Erde, das Mittelmeer zum Beispiel, adäquate Objekte birgt. Das ist meine Chance, und ich eile, diese zu nutzen. Auch das ist schließlich nicht einfach, denn nicht einmal der vielgereiste Odysseus, welcher seinerzeit den Phaiaken erschöpfende Kunde von der Tier- und Untierwelt des Mittelmeeres brachte, wußte vom Mondfisch zu sagen.
Überhaupt kommt das Wörtchen "Mond" in der vieltausendversigen Odyssee nicht ein einziges Mal vor..
Nur die Bürger zu Schilda, die wir zu unseren Vorfahren zählen, tunkten bereits lange vor des Ithakers Reise-, bericht - denn sie lebten ja, nach vielerlei Begebenheiten zu urteilen, viel weiter zurück als jener - ihre eschenen und eichenen Zinken in den Dorfteich.
Ich bin nicht unstolz auf solche Vorfahren. Es ging ihnen ja nicht um schnöden Gewinn, sondern sie wollten den Mond erretten. Und in ihrem Beginnen beschränkten sie sich von Anfang an klug darauf, einem Phantom nachzujagen. Wenn aber, wie der Mond mir versicherte, am Ende aller Errungenschaften nur wieder die unstillbare Sehnsucht nach noch Unfaßbarerem bleibt, also zuletzt dem Phantom, so haben die Schildaer sich eitle Umwege erspart und dennoch bewiesen: Selbst im erfolglosen Bemühen, wenn nicht gerade darin, wird es nur beharrlich und mit sparsamsten Mitteln betrieben, liegt Größe. Und so kehrte ich, selbst wenn die goldene Träne des Mondes sich nicht im Mittelmeer zeigte, von einer solchen Fahndung reicher an Einsichten zurück als der listenreiche Odysseus.
DAS DRITTE KAPITEL UMFASST
DEN GESICHTSKREIS DER ALTEN WELT
VON HESIOD BIS HIN ZUM PARADIESE
So weit überzeugt, mag nun einer dennoch fragen: "Warum willst du dann ausgerechnet ins Mittelmeer, obschon ein beneidenswertes Geschick dir unter den Meeren freie Auswahl bietet? Wo selbst Homer dort von dem Mondfisch nicht zu berichten wußte, letzterer als Bewohner wärmerer Gewässer doch viel aussichtsreicher in der Karibensee zu suchen wäre, im Golf von Mexiko oder in der Sargassosee, hinter dem Atlantik?" Und man mag mir vorrechnen, daß es viel ökonomischer wäre, jenen - für derart unbegründete Reisevorhaben ohnehin langwierigen - Prozeß der Visaerlangung gleich für fernere Reiseziele anzustrengen. Die Deutsche Seereederei unterhält doch Frachtschiffslinien, auch solche mit Passagierplätzen, nach Kuba, China, Japan, Mexiko, Indonesien, Westund Ostafrika, Brasilien, Argentinien, also in alle Welt. Rein verwaltungstechnisch ist es nicht schwieriger, eine Kabine nach Ostasien zu buchen als gleich "da vorne hin".
Was kann man solch fein umschriebenem Vorwurf, ein Tropf zu sein, im Zeitälter der komplexen Rationalisierung schon groß entgegenhalten. Ich lasse mich daher auf rationale Argumentationen gar nicht erst ein. Ließen sich etwa unsere Altvordern auf der Jagd nach dem Wassermond von neungescheiten Ansichten beirren? Es ist mein rechtmäßiges Erbteil, nicht nach dem Ferneren zu trachten, bevor nicht alle Weiher und Tümpel um den Wohnplatz herum gründlich abgesucht sind. Und was heißt denn überhaupt "Ferne", und was bedeutet heutzutage "näher"?
Man kann mit dem Düsenklipper den geographisch fernsten Punkt der Erde praktisch vor einem einzigen Sonnenumlauf erreichen. Das Physische wie das Geographische wird auch hier wieder zur zweitrangigen Größe, und das Ferne zählt nicht nach Kilometern, sondern identifiziert sich mit dem zurückgelegten Weg der Menschheit. Der Ursprung wird dabei zum Fernsten, und das Nächstliegende für den Fernfahrer ist daher, die Küsten des Ursprungmeeres aufzusuchen, jeder nach seinem Kulturkreis.
Damit amortisiert sich das Materielle am besten durch eine Fahrt ins Altbekannte.
Und bekannt ist das Mittelmeer weiß Gott schon lange genug. Schon vor zweitausend und fünfhundert Jahren ungefähr hatte Hesiod eine ziemlich genaue Vorstellung von seinen Küstenlinien. Es war das Meer der Alten Welt, und trotz der schiffeverschlagenden Stürme verband es die Anwohner mehr, als es sie trennte. Sieht auch das gesamte Weltbild des Hesiod einem frisch in die Pfanne gehauenen Spiegelei, das auf dem Okeanos schwimmt, ähnlicher als einem brauchbaren Atlas, so hat doch der Hahnentritt des Zeus in der Mitte frappierende Ähnlichkeit mit des Mittelmeeres heutiger wohlbekannter Form. Der Raum von den Küsten landeinwärts hingegen wird, je weiter, je mehr, gemutmaßt. Bekannt ist noch die Donau. Sie fließt genau von West nach Ost. Dahinter erhebt sich das Rhipäengebirge, scheinbar unüberwindlich. Es setzt die Grenze zwischen dem wildesten Norden, wo nur die Hyperboräer wohnen, und der eigentlichen Welt. Vom Rhein (Eridanos), wo bereits nach dem Wassermond gefischt wird, hat man vage Kunde. Ein halbkreisförmiges Randgebirge, wahrscheinlich Skandinavien, von welchem fernekundige Seefahrer, die bekanntlich nie lügen, bestimmte Nachricht gebracht haben mögen, bildet den Abschluß der nördlichen Welt.
Ähnlich radikal wird mit der Südhälfte der Weltscheibe verfahren. Die Wüste erstreckt sich bis ans südliche Meer. Ein Gebirge fehlt gänzlich. Und so wird hier der Weltendiskus vom Atlas bis zum Kaukasus in kühnem Halbkreis abgezirkelt.
Damit ist das Bekannte ins Unbekannte, das Konkrete in mutige Abstraktion phantasievoll eingebettet. Zweihundert Jahre weiter, aber noch immer fünfhundert vor "unserer Zeit", ist das Küstenhinterland schon genauer erkundet. Der Nil kommt aus Indien, der Ister fließt mehr in südöstliche Richtung. Am Rhipäengebirge wird nicht gerüttelt. Aber das skandinavische Nordrandgebirge hat man über Bord geworfen. Der Griechen Sinn für Maß und Form duldet keine Unausgewogenheiten. Fehlt im Süden ein erhöhter Scheibenrand, braucht man im Norden auch keinen. So stellt man das Gleichmaß wieder her. Das Kaspische Meer ist entdeckt und erscheint auf der Karte mit offener Flanke nach China hin. Das Rote Meer und der Persische Golf sind Binnenseen.
Nach weiteren zweihundert Jahren Menschheitsgeschichte, ähnelt die Welt einem Krebs. Der Hellenismus ist ausgbrochen und hat auf die ausgewogene Scheibenform verzichtet. Er sprengte halt nicht nur in der Kunst die klassischen Ideale. Die Welt zieht sich nach Osten hin in die Länge. Der Krebsschwanz ist Indien. Das hat man dem Eroberungszug Alexanders zu verdanken. Die südliche Krebsschere, nach Westen hin ausgreifend, heißt Libyen. Die nördliche Schere ist das Land der Kelten (Celtae). Die politische Benamsung von Landesteilen ist mithin eingeführt. Dafür hat man sich von dem politisch indifferenten Rhipäengebirge getrennt. Rückgrat des Weltkrebses ist der Taurus geworden. Wahrscheinlich hatte Alexander bei seinen Perserzügen an diesem Gebirge eine Nuß zu knacken, weil es nun so übergewaltig in der Topographie erscheint.
Die Welt ist aus den Fugen, dehnt und reckt sich. Erahnte neue Lände sind kühnstens angedeutet. Aber bekannt und bis auf das letzte Inselchen genau nachgebildet, liegt das Mittelmeer zwischen den Krebsscheren eingebettet.
Erst die Christen machen rund fünfzehnhundert Jahre später mir der peniblen Pingelei Schluß. Es geht ihnen nicht um formengetreue Wiedergabe der wirklichen Dinge. Sie haben den Nabel der Welt entdeckt, nämlich Jerusalem, und dem hat sich alles unterzuordnen.
Das Mittelmeer hat aufgehört, Sinnbild alles Wohlbekannten zu sein. Es ist lediglich eine Wasserstraße nach dem gelobten Land und erscheint auf dem Weltbild der frommen Psaltersänger als ein zusammengedrückter Schlauch. Am Ostende teilt sich dieser Zufahrtsschlauch in zwei waagerechte Arme, an dessen linkem beziehungsweise rechtem sich das Schwarze Meer und an dessen rechtem beziehungsweise linkem Arm sich das Rote Meer ballt. Die Mittelmeerfigur der Hochchristen gewinnt damit erstaunliche Ähnlichkeit mit dem gekreuzigten Heiland. Das ist also inzwischen aus dem vielversprechenden Hahnentritt des Zeus auf dieser Erde geworden. Es gibt einen meilenbreiten, um nicht zu sagen armstarken Zugang zum Roten Meer, aber keinen Ausweg daraus. Das wußte Ptolemäus lange zuvor schon weit besser. Aber Christus braucht eben zwei ohnmächtig festgenagelte Fäuste - damit er den Kartenzeichnern nicht an die Gurgel fahren kann. Selbst die Kreuzesnägel in Form willkürlich, aber wohlgesetzter kleiner Inseln fehlen nicht.
Es fehlen all jene Besonderheiten, die dem Mittelmeer seine eigenwillige Form verleihen, als da sind: Gibraltarstraße, Apenninenhalbinsel, Große Syrte, Adria, Hellespont usw. Aber für ihren Run nach ewiger Seligkeit ist den Kreuzfahrern diese Rennstrecke ins Zentrum der Welt so wichtig geworden, daß sich die gesamte Topographie nach ihrer Lage richten muß.
Der Norden ist demnach nicht mehr das kartenbestimmende Oben, sondern er wird links liegengelassen. Man kommt aus dem Westen, also vom unteren Kartenrand herauf, und hat das Mittelmeer oder vielmehr das, was von ihm noch übrig ist, in Blickrichtung voraus. Man lebt mit dem Blick nach Jerusalem, wohin man ebenso fasziniert starrt wie weiland die Schildbürger in ihren Entenpfuhl.
Alles, was links und rechts des Fahrwassers schon einmal sehr genau bekannt und verzeichnet war, ist vergessen oder wird ignoriert. Statt dessen gewinnt der See Genezareth die Größe und Ausdehnung des Schwarzen Meeres.
In puncto Abstraktion und Willkür bei der Darstellung des irdischen Antlitzes, wie es Gott erschaffen hat, schießen die Hochchristen den Vogel ab. Der Herr strafe sie darum mitnichten, denn dafür wissen ihre Kartographen, wo das Paradies liegt, nämlich an der Nahtstelle zwischen China und Indien, haargenau dort, wo heutzutage Napalm- und Spreng- und Gas- und Rasiermesserbomben auf das Land abgeregnet werden. Übrigens gibt es auch im Mittelmeer bis an die Zähne bewaffnete Amerikaner. Ihre Flugzeugträger kreuzen vor Zypern. Ob die dort auch den Mondfisch suchen? Oder was sonst ist der Gegenstand unstillbarer Sehnsucht jener Kreuzfahrer? Fern ist für sie die Heimat, noch ferner aber der Ort, an dem sie sich ge-rade aufhalten.
Damit beschließe ich jede weitere Argumentation. Wer das Ferne ..nicht von dem Nahen, das Nächstliegende nicht von dem Weiteren unterscheiden kann oder mag, der ist selber ein Tropf.
DAS VIERTE KAPITEL UMFASST
VERGLEICHE ZWISCHEN MITTELMEER UND HEIMISCHER OSTSEE
Denn an beider Küsten rollen ja unermüdlich die Wellen. Nur sind sie, wie mir scheint, noch immer durch das unüberwindliche Rhipäengebirge voneinander geschieden. So daß einerseits die blauen Sonnenküsten liegen und andererseits sich die grauen Nebel breiten. Dies ist der einzige wirkliche Unterschied.
Ähnlichkeiten gibt es dagegen recht viele. Wie jenes größere, so ist auch dieses kleinere Binnenmeer kaum von atlantischen Meeresströmungen berührt. Und dort wie hier nimmt das kontinentale Klima, wenn auch bei unterschiedlichen mittleren Temperaturen, von West nach Ost zu. Deshalb liegt es nicht fern, die Ostsee als das Mittelmeer des Nordens aufzufassen. An diesem Gewässer leben ebensoviele Völker, ebenso unterschiedlich in Sprache, Sitte und Geschichte, wie dort. Auf weit engerem Raum noch als dort im Süden drängen sich hier die Staaten.
Auch gibt es etwas Verwandtschaftliches in den natürlichen Entwicklungsbedingungen sowohl an den baltischen Ufern als auch im adriatischen oder ägäischen Raume. Hier wie dort gibt es ähnlich buchtenreiche, durch Meerbusen, Halbinseln, Inseln und Seestraßen abwechslungsreich gegliederte Konturen. Man vergleiche nur Jütland, Südschweden, ja die ganze Ostsee ruhig mit den völkergeschichtlich wichtigsten Teilen des Mittelmeeres: der griechischen Inselwelt und dem Peloponnes. Hier wie dort kann der Mensch vom Landesinnern aus das Meer in wenigstens einem Tagesmarsch erreichen. Die Bewohner der Ostseeküsten, Slawen wie Germanen, waren kühne Seefahrer gleich den Kretern und Achaiern. Die Stelle, wo der Mensch zuerst begann, Phantome der Sehnsucht in Tümpeln zu züchten, liegt freilich weiter landeinwärts.
Dem Kampf mit den Elementen am Meer ausgesetzt, gebrach es den Menschen des Küstenlandes hierzu an Muße. Aber es gibt noch weit mehr Beweise der Artverwandtschaft zwischen Ostsee und Mittelmeer. Denn als die Zeit der Bronze begann, zeitigte sie hier wie dort, voneinander durch über ein Jahrtausend getrennt, die gleichen kunstvollen Formelemente. Es wurde zuerst das schmuckbestimmte Metall zu Spiralen gebogen. Nirgendwo sonst als an den beiden Meerufern konnten-sich solche Formen entwickeln, denn die Spirale in Anwendung als Schmuck und Ornament ist eine Nachbildung der am Strande sich überschlagenden Welle oder von deren zurückflutendem Strudel. Ja, und hier wie dort waren es zuerst die großen Hansen, welche sich das schöngebogene teure Metall leisten konnten.
Es gibt demnach Gründe genug, der Ostsee das vorgenannte Prädikat zu erteilen. Selbst ein "Karthago des Nordens" hat sie aufzuweisen.
Und doch ist der eine Unterschied der bestimmende. Einer der Häfen hier oben heißt Wismar. Und Wis-Maie heißt: das weiße Meer. Name und Anschein, bestätigen es. Mitten im Kalendermonat des nordischen Frühlings stöhnt die Ostsee unter starker Vereisung. Die Hafenbucht ist geschlossen. Auf dem eisgetäfelten Parkett des Hafenbeckens trippeln die feinfüßigen Möwen. Eisbrecher müssen eine Fahrrinne offenhalten. Der Völkerfrühling setzte hier zweihundert übers Tausend der Jahre später ein als in der Ägäis.
Der Jahresfrühling lächelt hier in der Regel zwei Monate später als dort.
Mein Schiff erscheint mit zwei Tagen Verspätung am Kai. Aber die Stauer im Hafen wollen soviel wie möglich von der Verspätung aufholen. Es steht zu erwarten, daß sie, wo ganze Zeitalter schon aufgeholt wurden, auch die paar Stunden wieder herausholen werden. So wirkt sich der Unterschied aus zu dem sorgloseren, lange stagnierenden Süden.
DAS FÜNFTE KAPITEL UMFASST
ALLERLEI MUTMASSUNGEN UND VARIANTEN
Nämlich, da steht nun das Schiff zum Greifen nahe vor dir, Freund aus dem Landesinneren, sein Bug wölbt sich über dir wie der Schollenwender eines Riesenpfluges, und du mußt etwas dazu sagen. Bisher hast du dergleichen nur mittelbar kennengelernt. Aber nun kannst du das Schiff mit ausgestrecktem Arm berühren; kein Bildreporter klemmt seinen Entfernungsmesser zwischen dich und das Objekt. Faß es an, sag, daß es sich kalt anfühlt, eisern, meinetwegen groß, hart, plump, aber sag etwas.
Selbstverständlich würdest du lieber auf einem vielberuderten hölzernen Drachenschiff der Wikinger um die sieben Ecken des Kontinents segeln. Doch die gibt es nicht mehr, von wegen der Rentabilität. Du mußt dich mit dem begnügen, was deine Zeit dir bietet. Der Zweck heiligt die Mittel.
Du zögerst mit Worten, willst erst einmal das Deck betreten? Gut. Du irrst in den Gängen der mittleren Aufbauten umher, hörst vielleicht zufällig folgenden Dialog zwischen dem Kapitän und einem Werftbeauftragten:
Kapitän: "Die Bullaugen müssen neue Dichtungen bekommen."
Werftbeauftragter: "Welche Bullaugen?" Kapitän: "Alle, auch die obersten."
Daraufhin gehst du, ein günstiges Geschick läßt dich den Ausgang finden, wieder hinab, legst den Kopf in den Nacken, um nach den obersten Bullaugen auszuschauen. Die liegen oben auf dem Brückendeck in Höhe eines dreistöckigen Hauses. Du argwöhnst, es könnte, was die ho-merischen Helden noch "heilige Meerflut" nannten, unter Umständen bis dort hinaufschlagen. Du wärest zwar bereit, in noch viel kleinerem Nachen die See zu befahren, gewiß, doch ein banges Gefühl beschleicht dich trotzdem. Es wächst mit der Größe des Fahrzeugs zugleich das Ausmaß der Katastrophe, falls einmal etwas passieren sollte. Leugne nicht, natürlich denkst du daran.
Aber es gibt einen Trost. An dem gleichen Pier liegt ein Schwesterschiff nämlicher Klasse und Größe. Es schimmert in frischgestrichener Makellosigkeit. Das ist schon verdächtig. Ein Seeschiff ohne Schrammen und Beulen vermag kein Vertrauen erwecken. Dein Pott aber weist auf: die Narbenbrust eines erprobten Kämpfers, der schon ganz andere Sachen überstanden hat als die bevorstehenden. Nun wirst du zutraulicher und begehst den "Dampfer" vom Deck bis hinauf zur blau-roten Schornsteinbinde, dem Zeichen der Deutschen Seereederei.
Der Name des Schiffes steht am Vordersteven. Er paßt zur deutschen Heimat. Aber an der feinbronzenen Schiffsglocke entdeckst du noch einen anderen Namen eingekerbt: MS FERNRIVER. Und dabei läßt du es bewenden. Ohnehin kannst du auf Anhieb kein umfassendes Bild von all dem Neuen, das auf dich einstürmt, entwerfen. Alles, was dich dieser Verlegenheit etwas entheben kann, ist dir willkommen. Und FERNRIVER, siehst du, das klingt wie HERUMTREIBER: Und wenn du berücksichtigst, daß dieses Schiff norwegischer Herkunft von der Deutschen Seereederei gekauft und für die Trampfahrt in Dienst gestellt wurde, das heißt fernab von der Heimat und dem regelmäßigen Linienverkehr, so kannst du dir gar keinen besseren Namen denken. Es legt einmal hier, einmal dort und dann wieder in jenem Hafen der Südlevante an und ändert seinen Kurs je nach Ladung und Zuladung. Im stillen darfst du ja ohnehin alles Neue nach deinem Sinne benennen, denn du bist hier der Entdecket und niemand sonst.
Ringsum herrscht lebhafter Betrieb. Die Werftameisen krabbeln umher. Das Schiff wird zur großen Fahrt gerüstet. Kräne schwenken, Kranwinden wimmern. Aus dem Schiffsinnern kommt beständig ein irritierendes Beben. Dort läuft irgendeine jener Hilfsmaschinen, deren bemerkenswerteste Eigenschaft ist, daß sie stets größeren Lärm verursachen als die Hauptmaschinen.
Du findest es an der Zeit, daß dich jemand einweisen sollte, schließlich stolperst du ja überall jeglichem im Wege herum. Aber anscheinend hat jetzt niemand Zeit für Nebensächlichkeiten. Dafür wirst du dich schon noch rächen, Geduld!
Hart vor dir liegen sich nun zwei in den Haaren. Es geht um irgendwelche Pumpen. Natürlich, da so ein gan- zes Schiff ja nur für die Pumpen da ist. Du ahnst, daß es sich bei den Streithähnen nur um den leitenden Ingenieur, auch "Chief" genannt, und einen Spezialisten von der Werft handeln kann, denn einer will immer alles besser wissen als der andere.
Auf dem Vorschiff türmen sich die Haare zu Berge, nicht die des Chiefs und des Werftspezialisten, sondern die vorderasiatischer Bergziegen, die nach Antwerpen bestimmt sind.
"Herumtreiber" befördert nämlich am seltensten Waren aus der DDR, diese sind den Linienschiffen vorbehalten, sondern er betreibt eine Art Haus-Haus-Güterspedition. Er ist als Stückgutfrachter deklariert und befördert alles, was anfällt. Volkswirtschaftlich gesehen, ist er ein reiner Devisenschrapper zwischen internationalen Häfen. Hamburg, Rotterdam, Antwerpen, Liverpool, auch schottische und irische Häfen verbindet er mit allen möglichen Anlegestellen, der Südlevante. Dabei potenzieren sich die Ladungsmöglichkeiten mit der Anzahl der im Operationsgebiet vorhandenen Häfen. Schon bei einer einfachen Dreiecksfabel, sagen wir: zwischen den Häfen A, B und C, kann es bereits dreimal drei Bezugsvarianten geben, nämlich: A zu B, A zu C, B zu C, und so weiter.
"Herumtreiber" läuft wenigstens zehn Häfen an. Das sind Labyrinthe von zehnmal zehn Handelsbeziehungen mit ebensovielen möglichen Ladungsvarianten. Dabei kann es passieren, daß Ziegenhaare aus dem vorderen Orient nach Antwerpen über Wismar gehen, vorausgesetzt, sie sind nicht gerade als Expreßfracht etikettiert.
Du siehst einen Mann an der Ladeluke stehen und sich das Kinn knebeln? Dann kann es nur der Ladungsoffizier sein. Wenn es dir nicht vor allen Dingen darum zu tun wäre, bald auf Mondfischfahndung auszulaufen, dann würdest du Muße finden, den Hut vor diesem Mann, wie vor allen anderen Seeleuten, zu ziehen.
Dieser steht aber vor allen anderen ständig im Kampf mit knobeligen Problemen. Er muß die Ladung nicht nur so unterbringen, daß die für den nächsten und übernächsten Hafen bestimmte dort auch wirklich greifbar ist; er muß sie nicht nur so unterbringen, daß sie nicht verdirbt, beschädigt wird oder von andere Ware Gerüche anzieht - wer will schon Apfelsinen, die penetrant nach Ziegenhaar riechen? -, sondern er, der Ladungsoffizier, ist zugleich für die Stabilität des Schiffes verantwortlich.
Zu viel Schwergut, Eisen etwa oder Baustoffe, in den unteren Räumen verstaut, würde das Schiff "steif" machen. Es würde im Seegang nicht mehr rollen, sondern aus jeder Schräglage wie ein Stehaufmännchen auf den Kiel zurückschnellen. Schiff und Besatzung bekämen diese harten Bewegungen unangenehm zu spüren. Aber auch die Ladung kann sich dabei selbständig machen und "übergehen". Und dann, na ja. Du bist hier Entdecker und mußt mit allen möglichen Überraschungen rechnen.
Zu viel Eisen oder anderes schweres Gut in den oberen Räumen hingegen verlagert den Schwerpunkt des Schiffes nach oben, höher vielleicht, als gut ist. Das Schiff reagiert dann langsamer auf die seitlichen Wellenbewegungen, es richtet sich später auf. Es heißt, die Schiffsbewegungen werden "weich". Werden die Bewegungen zu weich, benötigt also das Schiff, als Faustregel, zum Wiederaufrichten aus einer Schräglage mehr Sekunden, als die Brücke an Metern lang ist, dann gilt es als unstabil. Wenn ein solches Schiff nicht auf den Kiel kommt, bevor die nächste schwere Dwarssee es wieder auf die gleiche Seite wirft, und es zu kentern droht, dann, spätestens dann merkt der Seemann; daß etwas mit der Ladung nicht in Ordnung ist. Und bevor er ins Boot geht, quittiert der Ladungsoffizier einen strafenden Blick des Kapitäns.
DAS SECHSTE KAPITEL UMFASST
SOVIEL WIE MÖGLICH HAFENSZENERIE
Große Schiffe am Pier erwecken den Eindruck, als wären sie von Grund auf unverrückbar hochgemauert. Da ist keine Spur von der graziösen, wassergetragenen Schwebe selbst der schwersten Dampfer, die, erst in der Dünung des weitläufigen Ozeans voll zur Geltung kommt. Archimedes - wir kommen von den alten Griechen nicht los - hat als erster festgestellt, daß ein Schiff dann schwimmt, wenn das Gewicht der von ihm verdrängten Wassermenge gleich seinem Eigengewicht ist. Schön ist es freilich, wenn ein Schiff dann noch um einiges über die Wasseroberfläche hinausguckt. Denn dann erst kann man noch dies oder jenes zuladen, was ja der Sinn dieser Schwimmkörper ist. Schiffe sollten deshalb möglichst so gebaut sein, daß sie bei genügender Festigkeit mit der gesamten Ausrüstung noch bedeutend leichter sind als die beim Eintauchen bis zur ingenieurbestimmten Sicherheitsmarke verdrängte Menge Wassers.
Dies sind die wichtigsten meiner auf Archimedes aufbauenden Schlußfolgerungen: Es geht im Prinzip bei Frachtschiffen um die Zuladung und nicht um die äußeren und inneren Abmessungen. Letztere sind mehr für die Steuer- und Patentfachleute von Wichtigkeit. Ein Schiff ist ja nur frei, solange es sich auf höher See befindet. Kaum nähert es sich dem Lande, verstrickt es sich schon im Netz der Zahlungsverpflichtungen. Es hat Lotsengelder zu zahlen, Schleppergebühren, Kanalgebühren, Bugsiergebühren, Eisbrechergebühren, Hafengebühren, Zollgebühren, Maklergebühren, Liegegelder, Versicherungsprämien, Abfertigungsgebühren, Konsulardienstgebühren, Leuchtfeuerabgaben, und schließlich, wenn es eines Tages, gleich einem Ackergaul, irgendwo liegenbleibt, hat es auch noch seine Bestattungsgebühren, das sind Abwrackgelder, aufzubringen. Nur ganz gerissenen Reedern gelingt es, letztere zu sparen, indem sie rechtzeitig die Versicherungsgesellschaft bemühen.
Eine Menge Verordnungen und Konventionen ranken sich um ein dienendes Schiff, und die meisten von ihnen halten sich an die äußeren und inneren Maße. Diese bleiben nämlich konstant, während Warenpreise und Frachtgebühren, alle beweglichen Werte sozusagen, den Weltmarktschwankungen unterliegen.
Es wird viel technisches und konstruktives Können aufgewendet, beim Bau eines Schiffes die zu Zahlungen verpflichtenden Abmessungen einzuschränken, um damit die Steuer zu täuschen. Diese kommt früher oder später hinter jeden Trick und arbeitet neue Bestimmungen aus, die ihrerseits wieder konstruktiv umgangen werden wollen. So treiben Schiffbauer und Verordnungsschöpfer ihre Leistungen gegenseitig in die Höhe.
"Herumtreiber" kann, wenn dir das etwas nützt, in seinem geräumigen Bauch rund viertausend Tonnen Fracht befördern. Ist dies der Fall, dann lohnt sich eine Fahrt trotz aller Abgaben dennoch. Ein bis zum Eichstrich eingetauchtes Schiff ergibt erst den richtigen Einklang zwischen Form und Bestimmung. Ein vollgeladenes Schiff, ob klein oder groß, das ist das Schöne an sich und das Gute für uns.
Am Kai gegenüber, wo die großen Getreidesilos stehen, liegt ein solcher Kahn zu Wasser. Sein Deck ist nahezu mit der Pierebene gleich. Saugrüssel tasten darüber hin, tauchen in die Ladeluken hinab und beginnen gierig zu schnorcheln. Vom Passagierdeck des "Herumtreibers" aus gesehen; sind seine Abmessungen bescheiden. Aber die Sauger rüsseln ununterbrochen, den ganzen Tag und auch die Nacht hindurch. Am nächsten Morgen steht das Schiff so weit emporgetaucht, daß mir sein Name an der Bordwand fast in Augenhöhe gegenüberliegt. 10000 Tonnen Weizen sind mittlerweile aus dem Schiffsrumpf gesogen worden. Das Schiff wuchs empor, und mit ihm, durch seinen Namen, wuchs hier gleich gegenüber das Bild dunkler Kiefernwälder, eine herbe Landschaft, überragt von himmelhohen Schornsteinreihen, mit denen der Mensch die rauchgetönte Nachricht an die Wolken pinselt: Strom; Strom, Strom.
Das Schiff heißt "Trattendorf", wo sie mit Kunst die Sonne von der Erde sondern. Aus schwarzem "Dreck" wird heißflüssige Elektrizität. Und wie ein schwimmendes Hochhaus türmen sich die achtern gedrängten Aufbauten des "Bulkcarriers" - so nennt man diese Massengutfrachter, er stammt aus eigener Produktion - selbst noch über die Brücke unseres "Herumtreibers" hinaus. So kann sich einer täuschen, wenn ein Schiff zu Wasser liegt.
Noch weiter über der Hafenbucht blitzen Schweißfeuer durch den aufkommenden Nebel. Dort liegt die MathiasThesen-Werft. Die Umrisse eines Ozeanriesen sind zu er-kennen, und durch das Fernglas sogar der Name: "Taras Schewtschenko". Ein 24000-Tonner. Das Wetter ist umgeschlagen. Warmluft haucht übers Eis und wandelt sich in Dampf. Die Kräne fingern oben in dem Dunst umher. Weiter pieraus poltert es, als würden Eisenbarren auf Plattenwagen gehievt. Dort liegen die Küstenmotorschiffe. Der Nebel verschluckt den Arbeitslärm. Es bleiben Schemen vielfältiger Bewegung übrig.
Überall tauchen aus dem Nebel vielfältige Dinge hervor.
Die Kistenburg dort enthält eine komplett verpackte Baumwollspinnerei. Sie ist für Ägypten bestimmt. An anderer Stelle wartet ein ganzes Arsenal unterschiedlicher, gutvernagelter Rollen, von kaum einem Meter Durchmesser bis zur Doppelmannshöhe, auf den Linienfrachter. Sie stammen aus dem Kabelwerk Oberspree. Vielleicht wird damit der kanadische Weizen bezahlt?
Aber dann ist der Kai zu Ende. Eine Wächterbude fröstelt im Nebelhauch. Mal sehen, was dahinter noch kommt, nur so aus Langerweile, denn es gibt ja heute nur ein Ereignis, das mich interessieren könnte, die Abfahrt. Hinter der Wächterbude kommt ein abschüssiges Ufer. Es kommt ein Brettersteg ins Uferlose, mit einem rohgezimmerten Geländer. Ich will den Steg betreten. Aber zuvor kommt ein Schild. Erst lesen, dann handeln, das ist die eingeschliffene Maxime des zivilisierten Menschen. Denn er weiß, jedes Ding, selbst die lausigste Seebrücke des Kontinents, hat seine Bestimmung. Und sorgfältig von ordnungsgelenkter, wenn auch ungeübter Hand steht geschrieben: STEG ZUM ASCHE AUS KIPPEN.
Das ist die nüchterne Sprache des Nordens. Danach erst kommt das küstenverbindende Meer.
zur Seite "Werke und Texte"
